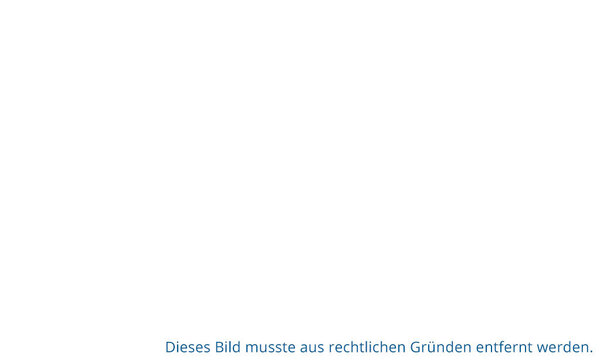Finanzen. Schon 1931 musste die Regierung mit der Creditanstalt eine Großbank vor der Pleite retten – mit ähnlichen Argumenten, die fast achtzig Jahre später bei der Kärntner Hypo Alpe Adria verwendet wurden.
In den vergangenen achtzig Jahren hat sich in Österreich wenig geändert: Immer wenn eine Großbank riesige Verluste verbucht, springt der Staat ein. SPÖ und ÖVP verstaatlichten seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 die Hypo Alpe Adria, die Kommunalkredit und das Volksbanken-Spitzeninstitut ÖVAG. Mit der Hypo-Rettung habe man einen „großen volkswirtschaftlichen Schaden von der Republik“ abgewendet, rechtfertigte sich der frühere Finanzminister Josef Pröll (ÖVP). Im Fall einer Insolvenz hätte ein Dominoeffekt gedroht. Pröll sprach von einer der dramatischsten Situationen für die österreichische Bankenlandschaft in den letzten Jahrzehnten. Laut Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) konnte mit der Hypo-Rettung „unabsehbarer Schaden vom Land Kärnten und von der Republik Österreich“ abgewendet werden. Bei den Verhandlungen sei man, erinnert sich SPÖ-Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, unter einem „irrsinnigen Druck“ gestanden.
Ähnliche Argumente waren 1931 zu hören, als die Creditanstalt vor dem Untergang stand. Der damalige Bundeskanzler Otto Ender (von der Christlichsozialen Partei) und Finanzminister Otto Juch luden am 11. Mai 1931 um halb zehn Uhr abends zur Pressekonferenz ein. Die „Neue Freie Presse“ erschien am nächsten Tag mit dem Titel: „Eine abgewendete Finanzkatastrophe“.
Die Zeitung befand sich damals auf Regierungslinie und druckte die Erklärungen des Bundeskanzlers und des Finanzministers im Wortlaut ab.
Nach Börsenkrach riesige Verluste
Die Creditanstalt wurde von der Familie Rothschild gegründet und stieg zur größten Bank der österreichisch-ungarischen Monarchie auf. Auch in der Ersten Republik war sie ein Machtfaktor, da sie einen Großteil der österreichischen Industriebetriebe betreute. Die vom New Yorker Börsenkrach im Jahr 1929 ausgelöste Weltwirtschaftskrise und die zuvor übernommene Boden-Creditanstalt sorgten für massive Verluste. Am 8. Mai 1931 gab das Institut für das abgelaufene Geschäftsjahr 1930 ein Minus von 140 Millionen Schilling bekannt. Die Regierung und die Nationalbank hatten nur drei Tage Zeit, um ein Rettungspaket zu schnüren. Es musste, so Kanzler Ender, eine „Katastrophe“ abgewendet werden.
Der Bund schoss 100 Millionen Schilling zu, obwohl er das Geld gar nicht hatte. Die Republik verschuldete sich damals über sogenannte „Schatzscheine“.
Im Leitartikel verteidigte die „Neue Freie Presse“ die Rettung der Creditanstalt: Der Regierung sei es in dreitägigen Verhandlungen geglückt, „einer unnennbaren, gar nicht zu schildernden Katastrophe beizukommen und drei Viertel der österreichischen Arbeiterschaft vor der Arbeitslosigkeit zu bewahren“. Es sei eine „selbstverständliche Tatsache, dass ein Finanzorganismus von so überragender Wichtigkeit nicht fallen gelassen wird und auch nicht fallen gelassen werden kann“, betonte das bürgerliche Blatt.
Wirtschaftliche Verbindungen zur CA
Teile des Leitartikels hätten in der „Arbeiterzeitung“, dem damaligen Zentralorgan der Sozialdemokraten, stehen können. Denn die „Neue Freie Presse“ forderte, dass man die „Schulden sozialisieren“ müsse, um die österreichische Volkswirtschaft vor dem Untergang zu retten.
Wer den Leitartikel geschrieben hat, lässt sich nicht mehr
feststellen. Der Autor wurde nicht genannt.
Der Leser wusste damals nicht: Die „Neue Freie Presse“ war wirtschaftlich eng mit der Creditanstalt verflochten. Nach dem Börsenkrach ging es mit der österreichischen Wirtschaft steil bergab. Firmen konnten Kredite nicht zurückzahlen.
Die Zeitung schuldete der Bank Geld
Auch viele Zeitungen kämpften ums Überleben. Die „Neue Freie Presse“ schuldete der Creditanstalt 1,5 Millionen Schilling, was damals viel Geld gewesen ist. Bei einer Pleite der Bank wäre der Kredit fällig gestellt worden. Das hätte vermutlich den Untergang der „Neuen Freie Presse“ bedeutet.
Zur Rettung der Creditanstalt musste die Regierung einige Gesetze beschließen. Auch ein Sparpaket war notwendig. So wurden beispielsweise die Zölle für Kaffee und Tabak erhöht und die Beamtengehälter gekürzt. Auch die Sozialdemokraten stimmten für diese Maßnahmen. Die Creditanstalt, die einst die monetäre Visitenkarte Österreichs genannt wurde, gibt es nicht mehr. Sie wurde von der Bank Austria übernommen, die zur italienischen UniCredit-Gruppe gehört.
Heute tritt „Die Presse“ dafür ein, dass marode Banken nicht immer mit Staatsgeld gerettet werden. Seit Beginn der Finanzkrise im Herbst 2008 fordert „Die Presse“, dass es ein Insolvenzrecht für Banken geben soll. Erst diese Woche wurden dafür in der EU die Weichen gestellt.
("Die Presse", 165 Jahre Jubiläumsausgabe, 29.06.2013)