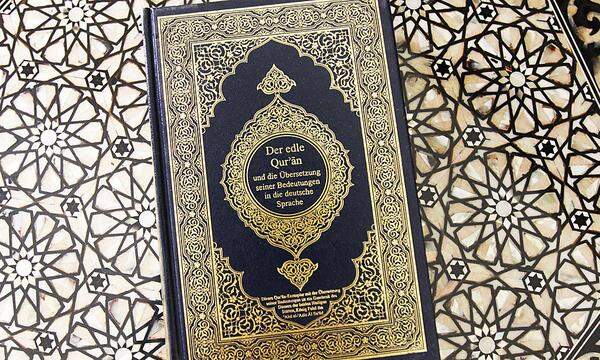Der Prophet Ezechiel aß das Wort Gottes, der Prophet Mohammed empfing es als Letzter, und der Reformator Luther mahnte: „Das Wort sie sollen lassen stahn.“ Über Wort- und Buchstabengläubigkeit in Offenbarungsreligionen.
»Was eint Thora, Koran und Bibel?
«
Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig.“
So wurde laut eigenem Zeugnis der israelitische Priester Ezechiel, auch: Hesekiel, zum Propheten berufen, zu einem fantastischen Propheten, der heute auch Ufo-Gläubige inspiriert, die die Erscheinung im ersten Kapitel seines Buchs als Landung von Außerirdischen interpretieren.
Doch was ist es für eine Schriftrolle, die Ezechiel verspeist? „Darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh“, heißt es, das ist wohl nicht als Inhaltsangabe zu verstehen. Der wilde Geschichtsphilosoph Oswald Spengler sah Ezechiels Buch als „erstes und zwar sehr bewusstes Beispiel eines ,Koran‘“, damit meinte er ein buchstäblich substanziell offenbartes Buch im Sinn der von ihm definierten „magischen Kultur“ (die spätes Judentum, frühes Christentum und den Islam umfassen soll). Die Thora war es ziemlich sicher nicht, was Ezechiel aß. Zu dieser hat er eine höchst unorthodoxe Haltung, die er Gott selbst in den Mund legt: Er habe, bekennt dieser dem Propheten, dem untreuen Volk Israel auch Gebote gegeben, „die nichtgut waren, und Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten“.
Ein wenig erinnert diese Revision einer heiligen Schrift innerhalb derselben heiligen Schrift an die „satanischen Verse“ in der 53. Sure des Koran. In ihnen ist von drei heidnischen Göttinnen die Rede, deren Fürsprache erhofft wird. Erst später, so die Überlieferung, habe Mohammed gemerkt, dass das eine (tendenziell polytheistische) Eingebung des Satans war, habe diese Verse aufgehoben („abrogiert“) und durch zwei andere ersetzt.
Satanisch?
Wäre das, könnte man naiv fragen, nicht eine Methode, um mit allen anstößigen – oder vermeintlich anstößigen – Stellen in Tanach, Bibel und Koran aufzuräumen? Dass man sie für satanisch erklärt oder für eine Täuschung Gottes? Sie durch Verse ersetzt, die uns besser passen?
Das geht natürlich nicht, denn da könnte ja jeder kommen. Genau das ist der Grund, warum alle Offenbarungsreligionen sozusagen einen Offenbarungsstopp eingebaut haben, warum keine neuen Kapitel der heiligen Bücher mehr geschrieben werden. (Aus diesem Grund war es Mohammed so wichtig, der letzte Prophet in einer langen Reihe zu sein.) Und auch keine Kapitel nachträglich in den Kanon aufgenommen werden. Dass die Mormonen glauben, dass ihrem Gründer Joseph Smith 1823 n. Chr. ein Engel namens Moroni erschienen sei und ihm Steinplatten überreicht habe, die sein Vater Mormon im Jahr 400 n. Chr. beschrieben habe, deren Inhalt Smith dann mithilfe weiterer Steine ins Englische übersetzt habe – es mag ungerecht sein, aber das wirkt auf uns komisch.
Die Abgeschlossenheit – und Vollkommenheit – der Thora ist ein zentrales Motiv der jüdischen Mystik, der Kabbala. Dabei kommt nach orthodoxer jüdischer Auffassung zur schriftlichen Thora eine mündliche Thora, die Mischna, die Basis des Talmud. Aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr. stammt eine Erzählung des Mischna-Lehrers Rabbi Meir. Er sei Thora-Schreiber, habe er einem seiner Lehrer erklärt, dieser habe ihm darauf gesagt: „Mein Sohn, sei vorsichtig bei deiner Arbeit, denn sie ist eine Gottesarbeit; wenn du nur einen Buchstaben auslässt oder einen Buchstaben zu viel schreibst, zerstörst du die ganze Welt.“
Ähnliche Aussagen gibt es im Islam. So heißt es in einem Hadith, also einem überlieferten Spruch: „Jeder Buchstabe des Koran ist besser als Mohammed und sein Haus.“ Womit natürlich arabische Buchstaben gemeint sind. Noch stärker war die Buchstabengläubigkeit in der islamischen Mystik, im Sufismus: Einige Sufis meinten, es sei segensreicher, sich die arabischen Buchstaben eines Korantextes anzuschauen, auch wenn man kein Arabisch versteht, als eine schlechte Übersetzung zu lesen.
„Ein nicht arabischer Koran ist innerhalb der koranischen Vorstellungswelt ein Widerspruch in sich selbst“, hielt der deutsch-iranische Orientalist Navid Kermani fest: „Der Gedanke, dass man ein Buch übersetzen, seine Sprachstruktur also verändern könnte, ist dem Koran völlig fremd. Mohammed ist gesandt worden, damit er als arabischer Prophet seinem Volk die Botschaft auf Arabisch verkündet.“
Schleier?
Die Schönheit des Koran, die Kermani in seinem Buch „Gott ist schön“ erklärt, hängt damit auch an seiner Sprache: einer Form des Arabischen, die heutigen Sprechern nicht ohne Weiteres verständlich ist, mit Wörtern, die heute nicht mehr verwendet werden oder ihre Bedeutung verändert haben. So bedeutet das Wort Sayyaratun in der zwölften Sure eine Gruppe von Reisenden, heute steht es für ein Auto. Viele Probleme der Auslegung haben ihre Wurzeln in solchen Veränderungen der Bedeutung: So heißt Hidschab heute Schleier, in der Sprache des Koran aber eher Trennwand: Mit dieser Bedeutung lässt sich aus den einschlägigen Koranversen – zumindest in der Meinung liberaler Exegeten – keine Kopftuchpflicht für Frauen lesen.
Der israelische Historiker Dan Diner sah in seinem Buch „Versiegelte Zeit“ im Festhalten der islamischen Kulturen an der arabischen Hochsprache (Fusha) – die freilich nicht völlig identisch mit der Sprache des Koran ist – einen Grund für den von ihm konstatierten „Stillstand in der islamischen Welt“: „Die arabische Sprache hütet das Erbe der historischen arabischen Nation in einer weit über das Funktionale hinausgehenden, magischen Weise“, schreibt er: „Jede substanzielle Veränderung oder Anpassung der Hochsprache gerät zum Sakrileg.“
Dass die sakrale Sprache altertümlich ist oder gar nicht mehr gesprochen wird, ist allerdings keine Besonderheit des Islam. Schon die Babylonier und Assyrer empfanden das Sumerische als angemessener für heilige Texte als ihr Akkadisch. Das Hebräische überlebte 1700 Jahre – von 200 n. Chr. bis ins späte 19. Jahrhundert – als sakrale Sprache; „loyshen koidesh“ (heilige Zunge) hieß es auf Jiddisch. Und die römisch-katholische Kirche hielt Jahrhunderte lang an Latein als sakraler Sprache fest – obwohl es natürlich nicht die Originalsprache der Bibel ist. Dass die Liturgie der Messe einem Großteil des Kirchenvolks nicht verständlich war, illustriert eine plausible Ableitung des Wortes Hokuspokus aus den Worten, die der Priester bei der Wandlung spricht: „Hoc est enim corpus meus.“ Ohne sich darüber im Geringsten lustig zu machen, kann man von der Heiligkeit des Unverständlichen sprechen.
Die reformatorischen Kirchen haben programmatisch das Lateinische durch die Volkssprachen ersetzt und – im krassen Gegensatz zum Islam – den Buchdruck als Instrument der Verbreitung gefördert: Das „letzte und zugleich größte Geschenk Gottes“ nannte ihn Luther. Dennoch gibt es auch in diesen Kirchen Tendenzen zur Bewahrung sprachlicher Formen – einfach weil die klassischen Übersetzungen wie die Lutherbibel oder die anglikanische King James Bible zwar von der Sprachentwicklung überholt wurden, aber im Ohr der Gläubigen – vielleicht gerade deshalb – eine besondere Würde haben. „Wahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ist es“, so begannen noch in den Achtzigerjahren evangelische Pfarrer das Lobgebet, wohl wissend, dass das Wort billig längst seine Bedeutung drastisch geändert hatte. Und wenn es in den Einsetzungsworten altmodisch lutherisch „Desselbigengleichen nahm er auch den Kelch“ hieß, mag das so mancher als besonders feierlich empfunden haben – und sich gegen eine Änderung mit einem Lutherzitat gewehrt haben: „Das Wort sie sollen lassen stahn.“
Selbstreferenziell
So kann man vielleicht als Christ verstehen lernen, warum den Muslimen der Klang des Koran so wichtig ist, warum sie so ungern über Übersetzungen verhandeln. Für sie wirkt ihr heiliges Buch erst im mündlichen Vortrag – genau das bedeutet das Wort Koran, das übrigens erstmals im Koran auftritt (und dort gleich 70-mal), der ja höchst selbstreferenziell ist. So wird in ihm öfter die eigene Sprachkunst gelobt: Die Ungläubigen könnten nicht eine einzige so schöne Sure schreiben, heißt es mehrmals, sie sollen es nur probieren . . .
Solche ästhetischen Lobpreisungen des Tanach bzw. der Bibel – die ja im Gegensatz zum Koran aus verschiedensten literarischen Gattungen besteht – findet man im Judentum und Christentum kaum. Dafür, etwa im Johannesevangelium, die Idee, dass das Wort das eigentliche Wirken Gottes sei. Die Kabbalisten trieben diese Idee wohl am weitesten: Die Thora sei der Name Gottes, sagten viele, manche gingen weiter und lehrten, dass Gott selbst die Thora sei. Wieder andere sprachen noch radikaler (und verblüffend an die Vorstellungswelt mancher theoretischer Physiker erinnernd) von einer verborgenen Ur-Thora, die noch ein Durcheinander von Buchstaben war – und erst durch die Schöpfung und die weitere Geschichte zum konkreten Text wurde – einem von unendlich vielen möglichen. Den dann auch jeder auf seine Fasson lesen und damit selig werden kann. Von der „unbegrenzten Plastizität des göttlichen Wortes“ schrieb Gershom Scholem, Professor für jüdische Mystik: „Im Grunde ist das wohl in der Tat die einzige Weise, in der man die Vorstellung von einem geoffenbarten Wort Gottes ernst nehmen kann.“
So zerfällt in der konsequentesten Mystik des Wortes das Wort, und damit die positive, gegebene Religion.