Überblick
Familie, Sicherheit, Rauchen: Der schwarz-blaue Koalitionspakt
"Zusammen. Für unser Österreich." So lautet der Titel des Regierungsprogramms von ÖVP und FPÖ für die Jahre 2017 bis 2022. Ein Überblick über die schwarz-blauen Vorhaben.

Volkspartei und Freiheitliche haben sich auf ein Arbeitsprogramm für die kommende Legislaturperiode (2017 bis 2022) verständigt. "Zusammen. Für unser Österreich" lautet der Titel des 182 Seiten umfassenden Koalitionspaktes, der sich in fünf große Kapitel gliedert: 1) Staat und Europa2) Ordnung und Sicherheit3) Zukunft und Gesellschaft4) Fairness und Gerechtigkeit5) Standort und Nachhaltigkeit Die "Presse" gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte.
(c) APA

Geschaffen wird ein "Familienbonus Plus". Dieser kommt in Form eines Abzugsbetrages von 1500 Euro pro Kind und Jahr. Der Abzugsbetrag steht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu, sofern Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und das Kind in Österreich lebt. Im Gegenzug erfolgt die Streichung des Kinderfreibetrages (440 bzw. je 300 Euro, wenn beide Eltern geltend machen) und der Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten (bis zu 2300 Euro pro Kind und Jahr). Der "Familienbonus Plus" ist nicht negativsteuerfähig. Um das Schaffen eines Eigenheimes zu erleichtern, sollen staatliche Gebühren und Steuern im Zusammenhang mit dem Eigentumserwerb wegfallen. Weiters soll der Arbeitslosenversicherungsbeitrag für niedrige Einkommen gesenkt werden. Antragslose Verfahren zum Erhalt von Familienbeihilfe werden ausgebaut. Leben die Kinder im Ausland, soll die beantragte Familienbeihilfe an die jeweiligen Lebenserhaltungskosten der Staaten angepasst werden.
(c) Clemens Fabry

Eingeführt wird eine erhöhte Mindestpension von 1200 Euro für Menschen mit 40 Beitragsjahren. Ehepaare erhalten bei 40 Beitragsjahren eines Partners zumindest 1500 Euro. Die Höhe der Pensionen sollen jährlich auf Vorschlag der Pensionskommission angepasst werden. Ein legistisches Mega-Projekt ist die Neukodifizierung des ASVG in verschiedene "Bücher". Neu ist vor allem, dass auch Pflege- und Arbeitslosenversicherungsrecht eingebettet werden sollen.
www.BilderBox.com

Etabliert werden soll eine neue Pensionsversicherungsanstalt als erste Säule einer neuen Sozialversicherung, die für alle Pensionen zuständig sein soll. Ein größerer Einschnitt ist eine Ablöse des Berufsschutzes durch einen Einkommensschutz. Eingeführt werden soll auch ein Teilpensionsrecht als Einkommensschutz, wenn ein erlernter und höher bezahlter Beruf auf Grund körperlicher Gebrechen nicht mehr ausgeübt werden kann. "Stufenweise, konsequent und nachhaltig" sollen alle noch verbliebenen Pensionsprivilegien abgeschafft werden. Die Altersteilzeit wird ein Stück zurückgedrängt. Das Zugangsalter soll um zwei Jahre auf 55 für Frauen bzw. 60 für Männer steigen.
Die Presse

Die Zahl der Sozialversicherungen soll deutlich reduziert werden. Die derzeit 21 Träger sollen auf maximal vier bis fünf Träger zurückgefahren werden. Außerdem vorgesehen ist eine Lohnnebenkostensenkung um 500 Millionen Euro (Absenkung des Unfallversicherungsbeitrags auf 0,8 Prozent). Die AUVA muss bis Ende 2018 Reformerfolge vorweisen, sonst wird sie aufgelöst.
(c) APA

Beim eigentlich für ab Mai 2018 geplanten Rauchverbot in der Gastronomie hat sich die FPÖ durchgesetzt: Die einst von SPÖ und ÖVP beschlossene Regelung wird gekippt. Gäste können daher vorerst weiter in abgetrennten Räumlichkeiten Zigaretten konsumieren. Zugleich wird der Nichtraucherschutz für Jugendliche verstärkt: Erst mit 18 Jahren wird Rauchen genehmigt, Unter-18-Jährige dürfen nicht mehr im Raucherbereich sitzen, fahren sie in einem Auto mit, darf dort ebenfalls nicht geraucht werden.
(c) APA

Das aktive Wahlalter bei Betriebsratswahlen soll von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden. Verbesserungen plant man im Schulärztesystem, etwa eine anonyme und elektronische Auswertung der schulärztlichen Untersuchungen und die Herausgabe eines jährlichen evidenzbasierten Gesundheitsberichtes auf Basis der schulärztlichen Untersuchungen. Die Kontrollinstrumenten bei Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Vier-Augen-Prinzip) sollen ausgebaut werden. Eine Digitalisierung der Schulbuchaktion wird geprüft.

"Menschen, die arbeiten oder jahrelang einen Beitrag für Österreich geleistet haben, sollen finanziell besser gestellt sein als andere, die das nicht tun oder getan haben", heißt es im Koalitionspakt. Konkret bedeutet das die Einführung einer "Mindestsicherung Neu". Pro Familie wird diesemit 1500 Euro gedeckelt. Für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte wird die Leistung auf 365 Euro Grundleistung sowie einen möglichen Integrationsbonus von 155 Euro reduziert. Anspruch auf Mindestsicherung hat außerdem nur, wer in den vergangenen sechs Jahren mindestens fünf Jahre legal in Österreich gelebt hat.
(c) APA

Eingeführt wird eine Arbeits- und Teilhabepflicht für Sozialhilfebezieher ab dem 15. Lebensjahr (bei Bildungsmaßnahmen keine Altersgrenze nach unten). Wird diese Pflicht verletzt kann es zur Kürzung bzw. vollständigen Sperre der Sozialhilfe kommen. Weiters geplant ist ein intensives Coaching und signifikante Kürzungen bei Arbeitsverweigerung oder Schwarzarbeit. Auch gibt es verpflichtende Beratungen zur Rücksiedlung in das Heimat- oder Herkunftsland.
(c) APA

Die neue Regierung bekennt sich zur Senkung der Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent (derzeit 43,2). Das Einkommensteuergesetz soll als "EStG 2020" umfassend reformiert werden - dazu soll zu Jahresbeginn eine "Taskforce" im Finanzministerium eingerichtet werden. Sie soll u.a. dafür sorgen, dass die Lohnverrechnung vereinfacht und zentral vorgenommen wird. Die Prüfer der Finanzämter und der Gebietskrankenkassen werden in einer Prüfbehörde zusammengefasst. In einem zweiten Schritt soll die gesamte Einhebung aller lohnabhängigen Abgaben durch die Finanzverwaltung erfolgen. Die steuerliche Förderung der Altersvorsorge soll "modernisiert" werden. Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen sollen unter dem Begriff "Abzugsfähige Privatausgaben" zusammengeführt werden.
(c) Presse

Österreich soll in puncto Tourismus wettbewerbsfähiger werden - und zwar durch die Senkung der Umsatzsteuer aus Übernachtungen von 13 auf zehn Prozent. Bei (Internet-)Bestellungen aus dem EU-Ausland soll ab dem ersten Euro Umsatzsteuer anfallen (bisher unterliegen Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern unter 22 Euro nicht der Umsatzsteuer). Als weiteres Ziel wird im Koalitionspakt die Sendung der Körperschaftssteuer (KöSt) ausgegeben. Wie, ist offen. Bagatellsteuern wie die Schaumweinsteuer sollen geprüft werden. Bei der Normverbrauchsabgabe ist ein aufkommensneutraler Systemwechsel mit Fokus auf den Verbrauch anstelle der Motorleistung angeacht. Die NoVA-Befreiung für hochpreisige Kraftfahrzeuge mit Hybridantrieb wird gestrichen.
APA/BARBARA GINDL
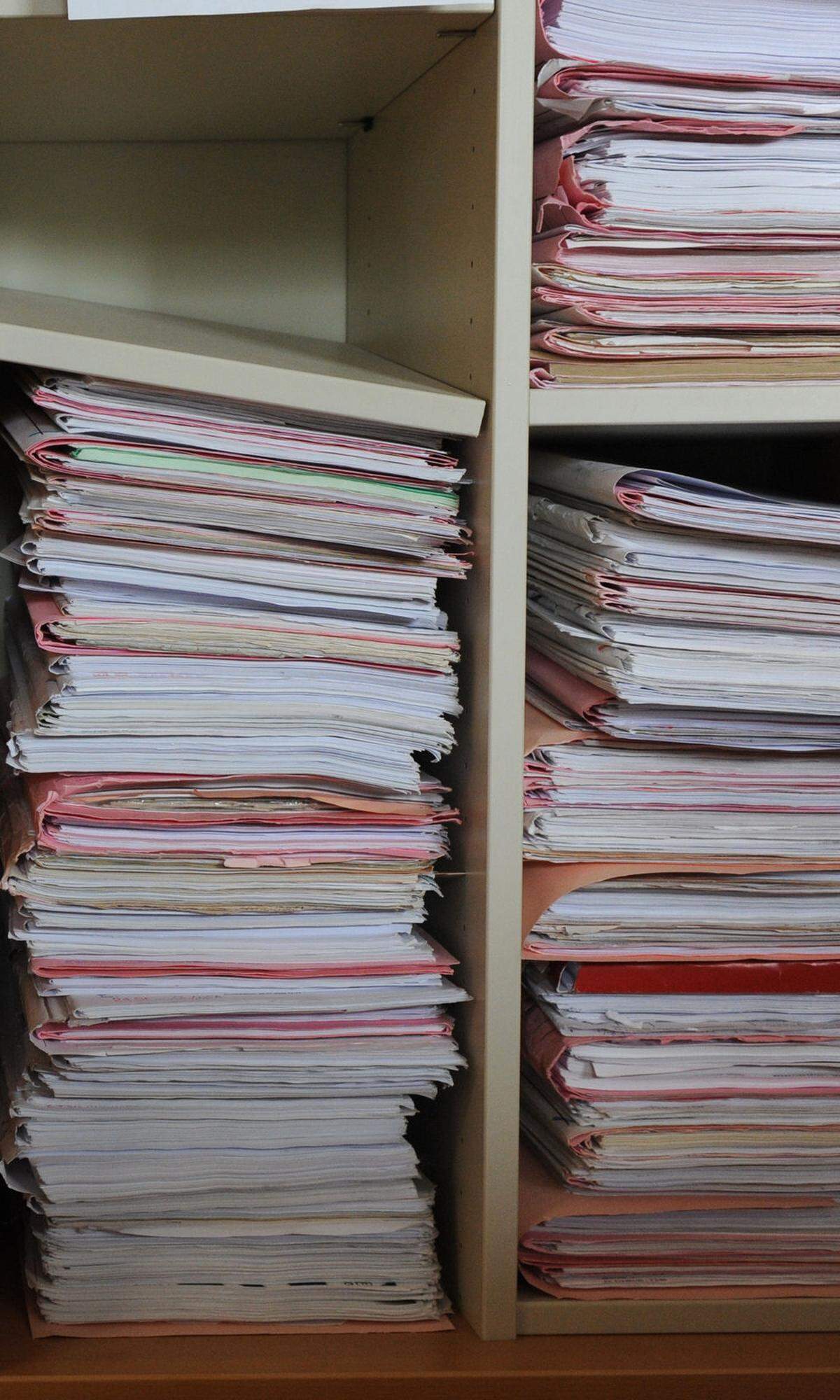
Im Wirtschaftsbereich wollen ÖVP und FPÖ die unter den Sozialpartnern höchst umstrittene Arbeitszeitflexibilisierung einführen - und die Höchstgrenze der Arbeitszeit auf zwölf Stunden täglich und 60 Stunden wöchentlich anheben. Ein weiterer Kernpunkt: die Entbürokratisierung. Alle neuen Gesetze sollen künftig einem "Bürokratie-Check" unterzogen und bestehende Vorschriften mit dem Ziel einer Reduktion durchforstet werden. Darüber hinaus ist eine Fachkräfteoffensive und die Stärkung der dualen Berufsausbildung geplant. Die Zulassung qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland soll "bedarfsorientiert" gestaltet werden. Arbeitszulassung und Zuwanderungsformen will man künftig klarer trennen. Die Rot-Weiß-Rot-Card soll weiterentwickelt werden. Neugestaltet wird das Arbeitslosengeld: Je länger man es bezieht, umso niedriger wird es. Auch die Notstandshilfe soll in diesem neuen Arbeitslosengeld aufgehen.

Bis zum Jahr 2030 soll der gesamte Strom in Österreich aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Außerdem will Schwarz-Blau Österreich zu einem Vorreiter in der modernen Umwelttechnologie machen, eine entsprechende nationale Klima- und Energiestrategie soll hierfür noch ausgearbeitet werden. Ziel sei aber jedenfalls, bis 2020 bei den Treibhausgasemissionen ein Minus von 16 Prozent gegenüber 2005 zu erreichen, bis 2030 sollen sie um mindestens 36 Prozent reduziert werden. "Green Jobs" sollen forciert und ein nationaler Aktionsplan für Bioökonomie beschlossen werden. Auf Kohle und Atomkraft soll vollständig verzichtet werden.
Die Presse
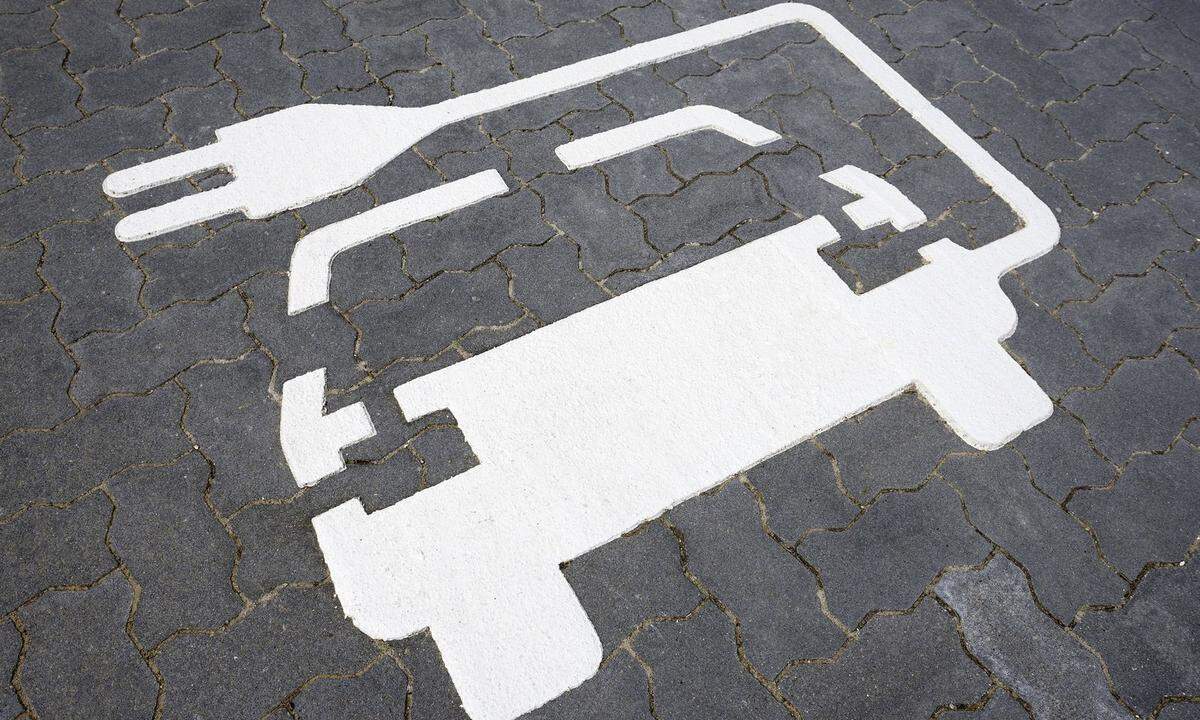
Geplant ist eine "Beschleunigung von Prüfverfahren bei Infrastrukturprojekten", um Projekte wie die Dritte Start- und Landebahn am Flughafen Wien oder den Wiener Lobau-Tunnel rascher umsetzen zu können. Weiters soll es ein besseres Fördersystem für Elektro-Autos geben sowie steuerliche Anreize für emissionsarmes oder emissionsfreies Fahren.
imago/Christian Ohde

Im Bildungsbereich setzt die neue Regierung auf die Einführung einer Bildungspflicht statt der bisher neunjährigen Schulpflicht, neue Leistungsüberprüfungen sowie den Erwerb von Deutschkenntnissen vor dem Eintritt in den Regelunterricht. Realisiert werden soll das zweite verpflichtende Kindergartenjahr - für Kinder mit Sprachproblemen bzw. mit anderen Auffälligkeiten. Im Kindergarten soll es wie schon jetzt Sprachstandsfeststellungen geben - wer es benötigt, soll verbindlich Sprachförderung erhalten. Das Kindergartenpersonal soll höhere Standards für die Aus-, Fort- und Weiterbildung bekommen - insbesondere soll das Leitungspersonal eine tertiäre Ausbildung vorweisen. Kindergärten sollen außerdem einen "verbindlichen Wertekanon" erhalten und die öffentliche Hand "verstärkte Kontroll-und Sanktionsmöglichkeiten" bei etwaigen Verletzungen.
(c) Presse

Wie bisher sollen schulpflichtige Kinder, die aber noch nicht schulreif sind, eine Vorschulklasse besuchen. Wer nicht ausreichend Deutsch beherrscht, muss eine "Deutschklasse" absolvieren. Beendet wird die verpflichtende Schullaufbahn nicht mehr wie bisher nach neun Jahren, sondern erst nach Erreichen bestimmter Kernkompetenzen (Lesen, Rechnen, Schreiben, soziale und kreative Kompetenzen). Wer diese nicht aufweist, muss nach Ende der neunten Schulstufe eine Förderklasse besuchen. In Sachen Leistungsbeurteilung gibt es ein Bekenntnis zur fünfteiligen Notenskala von Sehr Gut bis Nicht Genügend. Alternative Beurteilungen können zusätzlich vergeben werden. Die derzeit in diversen Gesetzen (Schulunterrichtsgesetz, Schulorganisationsgesetz etc.) enthaltenen schulrechtlichen Bestimmungen sollen künftig in einem einheitlichen Bundesbildungsgesetz aufgehen. Erhalten bleiben soll die Sonderschule.

ÖVP und FPÖ rücken in ihrem Regierungsprogramm im Kapitel "Europa und Außenpolitik" die Verankerung Österreichs als EU-Mitglied, die Neutralität, die aktive Mitwirkung in internationalen Organisation wie der UNO sowie eine "effiziente Entwicklungszusammenarbeit" ins Zentrum. Österreich werde als "integraler Teil" EU an deren Weiterentwicklung mitwirken und zwar in Richtung eines "Weniger, aber effizienter". Angedacht ist, dass das Parlament eventuell künftig Fragen prüft, ob Maßnahmen auf der bestmöglichen Verwaltungsebene (EU, Nationalstaat, Region, Gemeinde) geregelt sind. Die EU solle sich auf "die wesentlichen, für gemeinsame Lösungen geeigneten Themen" beschränken. Weitere Punkte im Bereich Europapolitik: Für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollen Verbündete gesucht werden.
(c) APA

Mehr Personal soll es für die Polizei geben. Bis 2019 sollen bis zu 2000 Ausbildungsplätze geschaffen werden. Entwickelt werden soll ein kombinierter Lehrberuf Verwaltungs- und Exekutivlehrling. Beschlossen werden soll ein Sicherheitspaket, mit dem Lücken bei der Überwachung internetbasierter Telekommunikation geschlossen werden sollen. Dabei dürfe es jedoch zu keiner "massenwirksamen Überwachung" kommen. Das Sicherheitspaket soll zudem zeitlich befristet beschlossen und parlamentarisch evaluiert werden. Eingeführt werden soll weiters ein Straftatbestand für nachrichtendienstliche Aktivitäten zum Nachteil von Privatpersonen. Auch wird die Möglichkeit zur Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler mit deutscher und ladinischer Muttersprache geschaffen.
(c) Presse

Als Ersatz für die Vorratsdatenspeicherung soll das Quick Freeze Modell kommen, also anlassbezogene Datenspeicherung in Verdachtsfällen. Und zur Terrorismusbekämpfung sollen staatsanwaltschaftliche Kompetenzen "gebündelt" werden. Asyl soll jenen Menschen für "die Dauer ihrer Verfolgung geboten werden, die Österreichs Hilfe wirklich brauchen". Individuelle Unterbringung für Asylwerber soll künftig nicht mehr möglich sein, zudem werden ausschließlich Sachleistungen zur Verfügung gestellt. Bei Antragsstellung wird den Asylsuchenden ihr Bargeld abgenommen zur Deckung der Grundversorgungskosten. Verkürzt werden sollen im Verfahren die Beschwerdefristen. Wenn eine positive Feststellung von Identitäten nicht möglich ist, kommt es zu einer negativen Feststellung.
(c) APA

"Weitere Strafverschärfung bei Gewalt- und Sexualdelikten" ist das vordringlichste Ziel der neuen Regierung im Justizbereich. Verschärft wird auch im Suchtmittelbereich - und zur Verfahrensbeschleunigung wird an Fristen gedacht. Auch an neue Tatbestände wird gedacht - und zwar mit Blick auf illegale Zuwanderer, also nicht nur zu Asylbetrug, sondern auch "Behördentäuschung durch Alterslüge". Bestrafen will Schwarz-Blau auch Gaffer, die bei Verkehrsunfällen Hilfskräfte behindern.
(c) www.BilderBox.com (www.BilderBox.com)
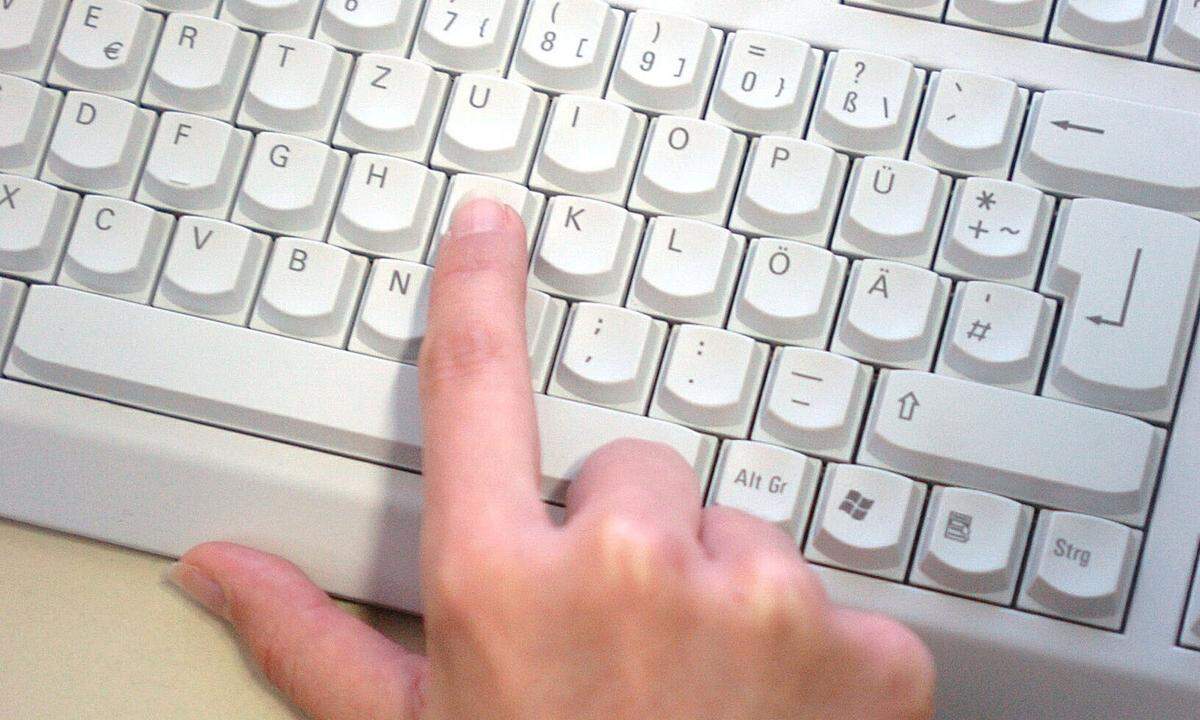
Schwarz-Blau will den flächendeckenden Breitbandausbau (zumindest hundert Megabit pro Sekunde) vorantreiben. Bis 2021 soll Österreich Pilotland im Bereich 5G-Ausbau werden. Außerdem plant die Koalition die Einführung eines "Bürger- und Unternehmerkontos", mit dem Amtswege online erledigt werden können. Unter dem Schlagwort "digitale Identität" sollen Bürger Personalausweis, Führerschein und E-Card etwa via Handy-App abrufen können - auf freiwilliger Basis.
(c) Presse

Relativ vage bleibt das Regierungsprogramm der ÖVP-FPÖ-Koalition in zentralen Punkten aus dem Bereich Wissenschaft. Geplant sind ein "Zugangsregelungs-Management" sowie "moderate Studienbeiträge". Wie ersteres aussehen soll und wie hoch zweitere sein sollen, steht nicht in dem Papier. Verschärft werden soll offenbar das Studienrecht, die ÖH bekommt strengere Vorgaben.
Die Presse

Volksabstimmungen über ein Volksbegehren sollen erst ab 900.000 Unterschriften (rund 14 Prozent der Berechtigten) verpflichtend werden - und auch das erst am Ende der Legislaturperiode, wenn sich die 2/3-Mehrheit findet bzw. nach einer Volksbefragung. 2022 soll die verpflichtende Volksabstimmung beschlossen werden.
(c) APA

Es kommt eine Novelle des ORF-Gesetzes, im Frühling soll die Enquete dazu stattfinden. Eine (Teil-)Privatisierung des ORF wird dezidiert abgelehnt. Eher vage sind die Aussagen zu ORF-Gebühren und Medienförderung. Zentral in der "neuen medienpolitischen Standortdebatte" sieht die neue Regierung die Weiterentwicklung und "Schärfung" des öffentlich-rechtlichen Auftrags, den man "im Gesetz genau formulieren will". Wie genau das aussehen wird, bleibt offen. Jedenfalls soll das "ORF-Gesetz NEU" eine "Weiterentwicklung der Strukturen und Gremien" des Öffentlich-rechtlichen bringen. Die unter Schwarz-Blau I errichtete Medienbehörde KommAustria sowie ihr Geschäftsapparat, die RTR, sollen eine "neue Organisationsstruktur" erhalten. Der

"Österreich kann nur frei sein, wenn seine Landwirtschaft imstande ist, die Bevölkerung mit einem Selbstversorgungsgrad von 100 Prozent mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen", heißt es im Programm. Geben soll es Exportinitiativen und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die bäuerliche Direktvermarktung, sowie eine Absenkung der AMA-Gütesiegel-Lizenzgebühren für kleine bäuerliche Betriebe. Des weiteren vorgesehen ist eine "bessere Absicherung für Land- und Forstwirte". Hohe heimische Standards sollen geschützt werden. Zudem wird die Einrichtung einer Task-Force "Zukunft Landwirtschaft und Lebensräume" angekündigt.
Die Presse
