Anschläge, Proteste und Unruhen prägten die Stadt in den vergangenen Jahren.
Sollte Paris neuerlich getroffen worden sein, diesmal im Mark, im Herzen der Stadt, wo sich Notre-Dame als Symbol der Kulturnation erhebt? Diese Frage drängte sich vielen Parisern auf, die in Scharen an einem lauen Frühlingsabend an der Seine zusammenströmten, wo aus der Kathedrale erst grau-gelbe Rauchschwaden aufstiegen und später orangerote Flammen aus dem eingestürzten Dachstuhl loderten. Sie eilten von der Rive Gauche herbei, dem linken Seine-Ufer, und vom nahen Rathaus.
Ein Verdacht richtete sich zunächst gegen die Gelbwesten, deren Proteste sich Samstag für Samstag wie ein leeres Revolutionsritual in der Innenstadt entladen hatte. Die Anarchisten des Schwarzen Blocks hatten längst das Kommando übernommen, Auslagen zu Bruch geschlagen, Denkmäler wie den Arc de Triomphe beschmiert. Aber an einem Montag, obendrein in der Karwoche, in der sich Touristen in Frankreichs Hauptstadt tummeln? Es wäre ein besonders perfider Akt. Die Bewegung der Wutbürger hat indessen zuletzt an Zulauf verloren.
Paris ist eine verwundete, verstörte Stadt, und das Terrortrauma ist noch allzu lebendig. Unweigerlich stiegen Erinnerungen an die IS-Anschläge der vergangenen Jahre auf: an das Attentat auf die Redaktion der frechen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ im Jänner 2015, der die französische Hauptstadt unvorbereitet traf, die Medienbranche aufwühlte und die Stadt tagelang in den Bann schlug.
Der „schwarze Freitag“
Die Attentäter töteten an jenem 7. Jänner zwölf Menschen, ein Komplize erschoss zwei Tage später vier Menschen im jüdischen Supermarkt Hyper Cacher und nahm daraufhin mehrere Geiseln. Beim Sturm auf den Laden durch eine Spezialeinheit kam der Attentäter ums Leben. Am Sonntag darauf demonstrierten Dutzende Staats- und Regierungschefs bei einem kurzen Gedenkmarsch ihre Solidarität mit Frankreich und François Hollande, dem damaligen Präsidenten.
Für kurze Zeit scharte sich die Nation um den glücklosen Staatschef. Zehn Monate später sollte Hollande die Abgeordneten im Schloss von Versailles zu einem Akt der Demokratie versammeln, und die Place de la République wurde zum Zentrum des Gedenkens nach der schlimmsten Anschlagsserie in der Geschichte des Landes. Das Denkmal quoll über vor Blumen, Kerzen, Karten und Zetteln, die an 130 Menschen erinnerten, die in Lokalen, Brasserien am Canal Saint-Martin und im Konzertsaal Bataclan aus dem Leben gerissen worden waren.
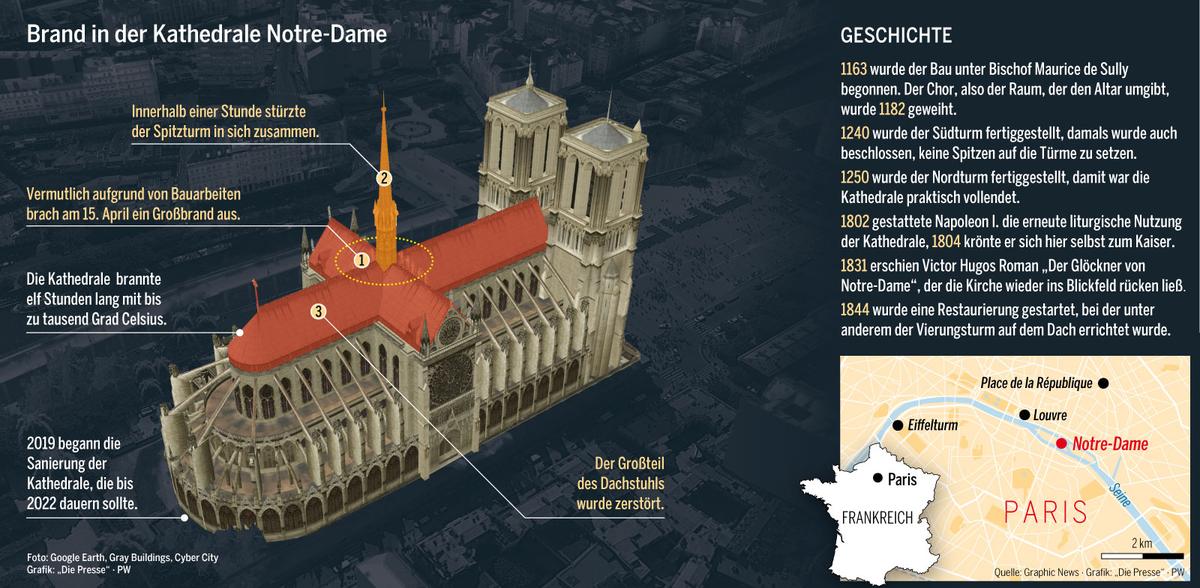
Es war ein „schwarzer Freitag“, der 13. November 2015, und die Unglücksnacht begann mit Detonationen vor dem Stade de France, beim Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland, von dem François Hollande während der Halbzeit ins Krisenzentrum aufbrach. Im kollektiven Gedächtnis der Franzosen ist der 13. November 2015 zum Äquivalent des 11. September 2001 in der Erinnerung der US-Amerikaner geworden. Hollande bezeichnete die Attentatsserie der IS-Täter, die Tage später bei einer Razzia gegen Mastermind Abdelhamid Abaaoud in Saint-Denis endete, als „kriegerischen Akt“. Seine Regierung rief den Ausnahmezustand aus.
Aufbäumen nach Niederschlägen
Bei der Fußball-EM ein halbes Jahr später war der Notstand noch in Kraft. In Feierstimmung bejubelte Frankreich den zweiten Platz seiner Equipe im Finale im Stade de France. Doch tags darauf – just am Nationalfeiertag, dem 14. Juli – schlug der Terror erneut zu. Nach dem nächtlichen Feuerwerk an der Promenade des Anglais in Nizza richtete ein tunesischstämmiger Attentäter ein Blutbad mit 86 Toten an der Prachtmeile an.
Schock und Verunsicherung waren zurückgekehrt. Die Terrorangst war nur kurzzeitig gebannt, Frankreich lebt jetzt bereits seit Jahren mit der Gefahr. Stets bäumen sich die Franzosen wieder auf, schütteln Tag für Tag die Bedrohung ab – in der Metro, in den Cafés und nun auch in den Kirchen.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2019)






