Auf ihrem dritten Album, „Serfs up!“, setzt die englische Psychedelic-Rock-Band auf vage Betrachtungen einer kalten Welt und ersetzt den Punk durch Funk.
Vor ein paar Jahren zirkulierte noch eine Aura der Gefahr rund um die 2011 gegründete Fat White Family aus dem Londoner Bezirk Peckham. Man hörte munkeln: Sänger Lias Saoudi ziehe sich nackt auf der Bühne aus und reibe sich mit Butter ein, Schweineköpfe würden bei Konzerten ins Publikum geworfen . . . Provokant, kontroversiell, der gute alte nihilistische Spirit des Rock 'n' Roll.
Auf „Serfs up!“, dem als Hommage an die Beach-Boys-Platte „Surf's up!“ betitelten dritten Album, rutscht der schlechte Ruf in den Hintergrund und macht Platz für eingängige Lieder, beeinflusst von mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte. Trotzdem darf die für die Band typische Provokation nicht fehlen. Nur bleibt diese im Hintergrund – vage und subtil. Doppeldeutigkeiten gibt es gleich im ersten Lied auf der Platte: „Feet, don't fail me now“, singt Saoudi und vermittelt mehrere Emotionen. Die Füße, die vor etwas weglaufen, könnten hier gemeint sein, als Lebensretter sozusagen. Oder die Füße auf dem Tanzboden, die sich zum eiligen Beat, zu den verwaschenen Gitarren und den funkigen Bässen bewegen. Nur noch ein wenig tanzen, jetzt noch nicht aufgeben, das ist die Grundstimmung.
Manchmal wirkt es, als ob die Zuhörer eingelullt werden sollten: Freundlich klopfen Rhythmen vor sich hin, untermalt von hellen Surfrockgitarren, Melodien bleiben leicht im Ohr. Und wenn man sich gerade zurücklehnen will, krächzt Saoudis Stimme herein, erzählt traurige Geschichten über triste Sonnenaufgänge im Süden Londons („Bobby's Boyfriend“), über Träume von der Flucht aus der Stadt („I Believe in Something Better“), oder er macht Vergleiche zwischen altem Rom, Babylon und Belfast („Rock Fishes“). Dann übersteuern plötzlich die Instrumente, Outros dauern die paar extra Sekunden zu lang, irgendwann taucht völlig außerhalb des Rhythmus das nervige Geräusch eines Autoblinkers beim Abbiegen auf. Ärgerlich, denkt man sich, bis man realisiert, dass das bei dieser Gruppe wohl alles absichtlich so konstruiert wurde. Ein kluges Spiel mit Störfaktoren.
Erinnerung an Primal Scream
Diese bleiben rar, der Fokus liegt auf Abwechslung: Wie heute so oft bei guter Musik trotzen die Instrumente der strengen Genreeinordnung. Freunde und Freundinnen des Psychedelic Rock vergangener Jahrzehnte können sich über entspannte Drumsamples und prägnante Bassriffs freuen (und sich an die wunderbare schottische Band Primal Scream erinnern, die Ähnliches schon Anfang der Neunzigerjahre gemacht hat). Aber man findet auch Einflüsse aus Disco, Jazz, Soul und Funk, stilistische Ausflüge, die bisweilen zu wahren Geniestreichen führen: „Oh Sebastian“, eine waschechte Ballade mit Streicheruntermalung, klagt über sinnlose Arbeit für einen Hungerlohn. Und auf „Tastes Good with the Money“ meditiert ein Männerchor über das süße, dekadente Leben in den Hollywood Hills.
Mit seinen gefälligen Rhythmen passt „Serfs up!“ gut zum Beginn der warmen Jahreszeit, ist aber dabei voll mit Beschreibungen einer kalten und unbarmherzigen Welt. Surfmusik für Strandhasser; ein Sommersoundtrack für Leute, die lieber daheim im Dunklen bleiben, statt am Strand herumzulaufen. Ein Album wie Urlaub zu Hause.
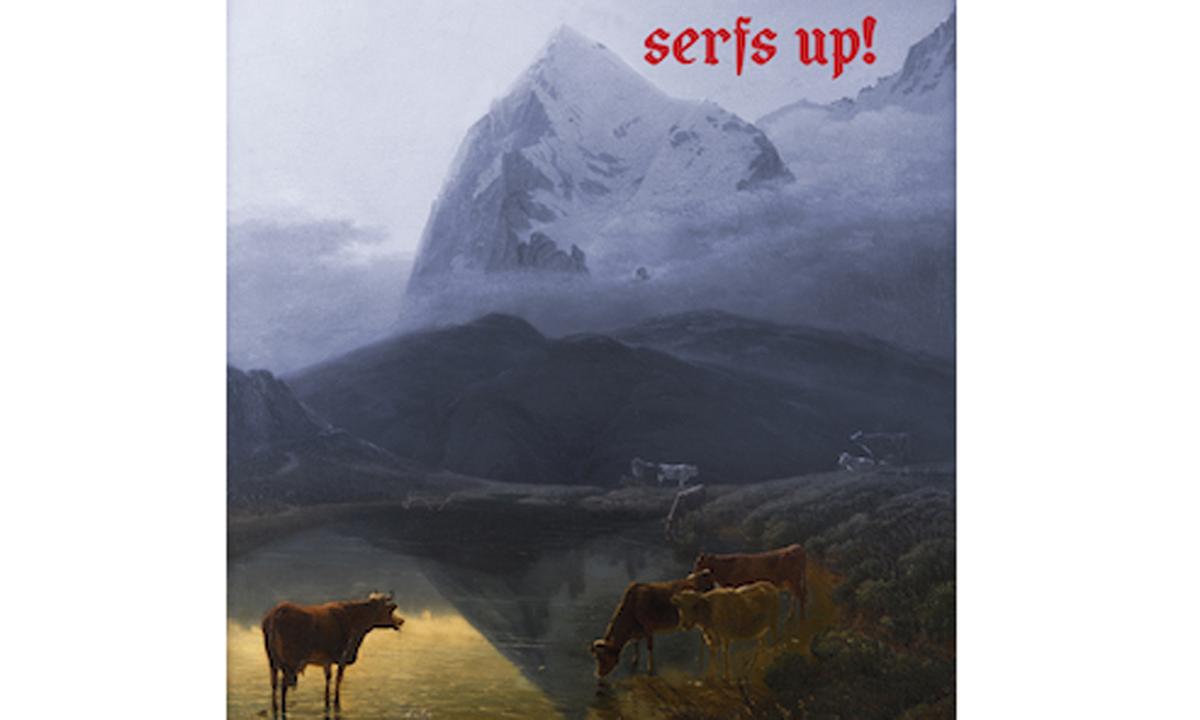
("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2019)
