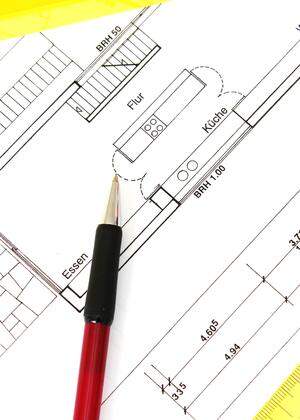Im Neubau ist die Energieeffizienz bereits seit Jahren fest verankert. Anders sieht es im Bestand aus – besonders bei Einfamilienhäusern gibt es diesbezüglich noch viel Potenzial. Und einige Förderungen.
Die Latte liegt hoch: Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Eine Schraube, an der gedreht werden muss, um dieses Ziel erreichen zu können, ist der Gebäudebereich. Immerhin verursacht dieser Sektor laut Umweltministerium derzeit rund zehn Prozent der österreichischen Treibhausgasemissionen und ist für rund 27 Prozent des österreichischen Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich. Zwar haben Bauordnungen und Wohnbauförderungsrichtlinien in den vergangenen Jahren den Trend zu nachhaltigem und energiesparendem Bauen, Heizen und Kühlen im Neubau deutlich beschleunigt. Anders sieht es aber im Bestand aus: Nach wie vor ist der Großteil der Altbauten in Österreich nicht saniert. Von den aktuell fast 4,8 Millionen Wohneinheiten weisen nach Angaben von Umweltbundesamt und dem Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) etwa 1,9 Millionen einen thermisch unzureichenden Standard auf.
Denn statt zu steigen, ist die Gesamtsanierungsrate bei Wohnungen von 2009 bis 2018 von 2,1 auf 1,4 Prozent gesunken. 2018 lag sie nur noch bei 0,5 Prozent, rechnen die Experten vor. Damit wurde das in der Klimastrategie 2010 definierte Ziel der Bundesregierung, die Sanierungsrate bis 2020 auf drei Prozent zu steigern, deutlich verfehlt. Eine Sanierungsrate von drei Prozent ist zudem auch im aktuellen nationalen Klimaplan vorgesehen.
Schlechte Substanz, gute Ideen
Potenzial gibt es dabei besonders im Einfamilienhausbereich. Vor allem, wenn es sich um Gebäude handelt, die zwischen 1945 und den 1960er- bis 1970er-Jahren errichtet wurden, weiß Johannes Hug, Energieberater bei der „Umweltberatung“. Nicht nur wegen ihrer großen Anzahl, sondern auch wegen des sehr viel höheren Energiebedarfs im Vergleich zu baugleichen Geschoßwohnungen, ergänzt IIBW-Geschäftsführer Wolfgang Amann. Das Dämmen der Fassade, der obersten Geschoßdecke beziehungsweise des Dachs und des Kellers sowie der Tausch der Fenster kann diesbezüglich deutliche Einsparungen bringen. Derartige Maßnahmen könnten den Heizwärmebedarf um bis zu 70 Prozent verringern. „Man kann bei der thermischen Sanierung tatsächlich in Richtung Passiv- oder Niedrigenergiehaus gehen“, sagt Hug.
Bevor diese Ziele definiert werden, sollten Hauseigentümer allerdings den Ist-Zustand erheben, rät Adolf Merl von Daxner & Merl, einem Büro für Nachhaltigkeits- und Umweltberatung. Jedes Gebäude sei anders, dementsprechend müsse an das Projekt Sanierung herangegangen werden. „Man sollte sich unter anderem die Struktur und Substanz des Gebäudes ansehen, den Wärme- und Energieverbrauch feststellen und klären, welche Materialien kombinierbar sind“, sagt der Bauingenieur. Auch Fragen nach der Nutzung des Gebäudes, den Auswirkungen von Maßnahmen auf den Platzbedarf und den Effekten sollten geklärt werden. „So können beispielsweise Schäden durch falsche bauphysikalische Entscheidungen vermieden werden“, sagt Merl.