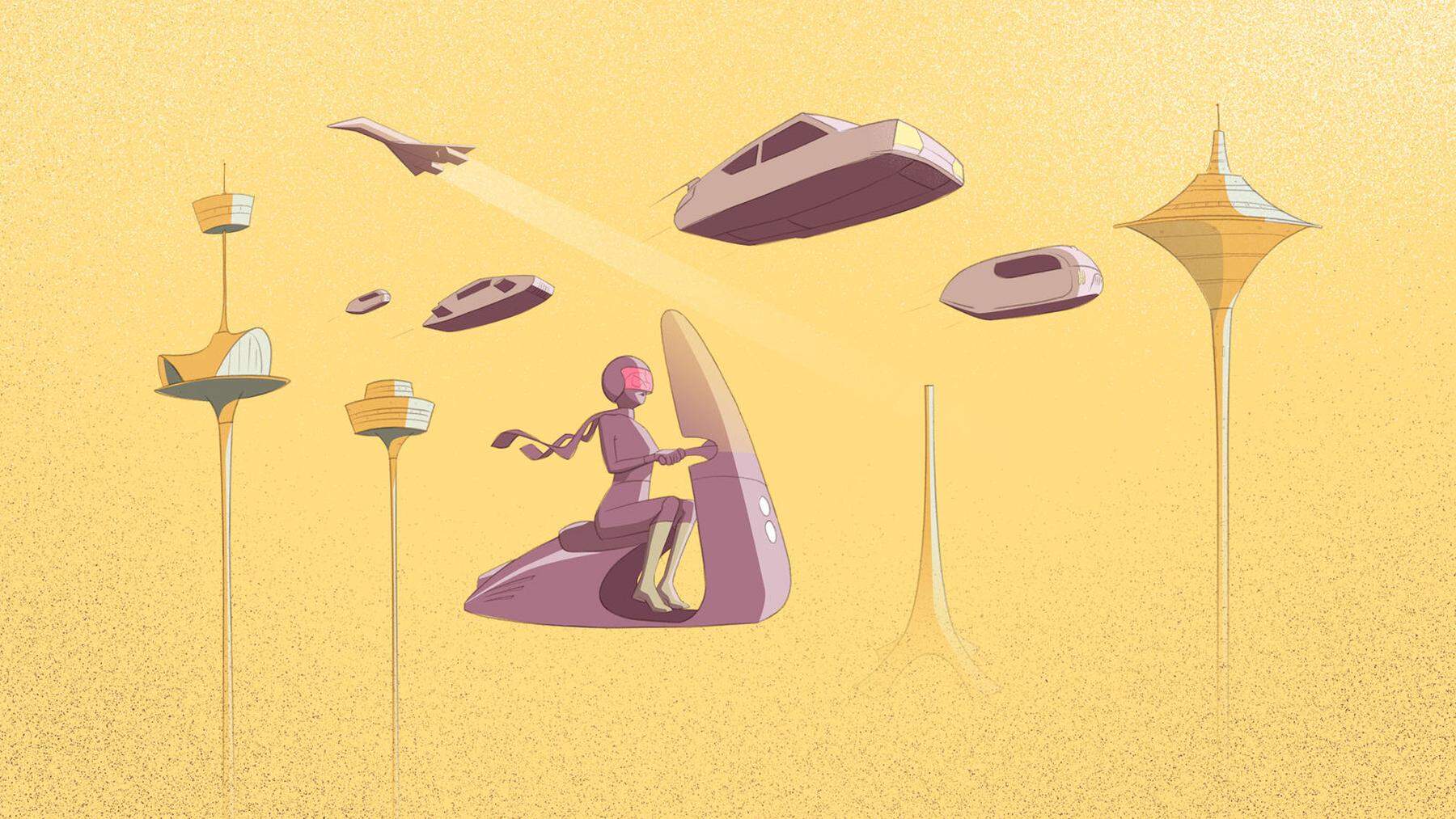Dieses Dossier wurde von der „Presse”-Redaktion in Unabhängigkeit gestaltet.
Es ist mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten sowie des Bundeskanzleramts möglich geworden und daher auch frei zugänglich.
„Brasilien ist das Land der Zukunft – und wird es immer bleiben.“ Dieser Slogan entstand als ironische Reaktion der Brasilianer auf die Begeisterung des vor den Nazis geflüchteten österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig, der sich mit dem 1941 veröffentlichten Buch „Brasilien – ein Land der Zukunft“ ein Dauervisum in dem vermeintlichen Arkadien Südamerikas sicherte. Doch in dieser Welt von Morgen konnte bzw. wollte sich der Autor der „Welt von Gestern“ nicht zurechtfinden. Im Februar 1942, nur wenige Monate nach der Veröffentlichung seiner brasilianischen Panegyrik, nahm sich der an Depressionen leidende Zweig unweit von Rio de Janeiro das Leben.
Was seine europäische Heimat anbelangte, hatte Zweig zwar auch eine Vision – doch diese war, im Gegensatz zur durch Brasilien verkörperten Neuen Welt, rückwärtsgewandter. Zweigs Vorstellung von Europa orientierte sich an einer idealisierten Donaumonarchie, in der die Völker Mitteleuropas, befreit von der Last der Politik, verwaltet von einer aufgeklärten Bürokratie und unter dem milden Blick eines gütigen Kaisers, ohne Sorgen und Konflikte ihr Dasein fristeten. Den Einigungsprozess nach 1945 konnte der Schriftsteller nicht mehr erleben.
Hätte er sich 1942, auf dem Höhepunkt von Hitlers Macht über Europa, gegen den Suizid entschieden, würde er vermutlich über die Entwicklung staunen, die sein Kontinent nach dem Fall des Dritten Reichs genommen hat: Denn die Architekten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften richteten sich in ihren Bauplänen nicht nach den Habsburgern aus, sondern blickten nach vorn. Ihr Europa sollte das wahre Land der Zukunft sein.
Im Spätherbst des Jahres 2020, am Ende einer Dekade der Krisen, Konflikte und Katastrophen, fällt es leicht, sich über den Zukunftsglauben lustig zu machen, der im Erbgut der Europäischen Union festgeschrieben ist. Wer über die EU Spott und Hohn ergießen will, verweist gern auf unerfüllte Hoffnungen und verlorene Illusionen – etwa das zur Jahrtausendwende feierlich gemachte Versprechen, die EU bis zum Jahr 2010 zur wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Volkswirtschaft der Welt zu machen; die Anfang der Nullerjahre beabsichtigte Neuschöpfung der Union mittels einer Europäischen Verfassung; oder das Unvermögen, diverse organisatorische Dauerprovisorien (beispielsweise die losen Teile der nach wie vor unvollendeten Bankenunion) zu fixieren.
Dass die Europäer die destruktive Technik der politischen Kernspaltung beherrschen, haben sie im Laufe ihrer Geschichte hinreichend oft bewiesen. Seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl Anfang der 1950er-Jahre arbeiten sie, zur Abwechslung einmal, an der Erforschung und Vervollkommnung der politischen Kernfusion – die, wie Hobbyphysiker (wie der Autor dieser Zeilen) zu glauben wissen, deutlich mehr Energie freisetzen kann als eine Fission. Und im Gegensatz zu früheren, teils desaströsen Vereinigungsexperimenten (von Napoleon über Stalin bis Hitler) handelt es sich diesmal um hundertprozentig positive, die ökonomische, ökologische und soziale Umwelt schonende Energie, die in Brüssel, Straßburg und den Hauptstädten der Unionsmitglieder generiert wird.
»Corona hat gezeigt, dass die EU nach wie vor gestalten kann – vorausgesetzt, ihre Mitglieder ziehen an einem Strang.
«
Vermeintlich naive Zukunftsgläubigkeit ist aber nicht der einzige Vorwurf, der an Brüssel gerichtet wird – am anderen Ende des Spektrums finden sich jene, die der Europäischen Union kleinmütige Ideenlosigkeit vorwerfen. In den Augen dieser Kritiker sind in der EU Ingenieure des Kleinstmöglichen am Werk, deren Hauptaufgabe darin besteht, aus visionärem Rohstoff Briefbeschwerer für die Brüsseler Bürolandschaften zu drechseln.
Die Zukunft ist nicht mehr das, . .
Es gibt aber auch noch eine dritte Seite der Medaille: nämlich die alte politische Maxime, wonach man etwas richtig zu machen scheint, wenn man deswegen von beiden Außenflügeln zugleich angegriffen wird. So betrachtet, leisten die europäischen Maschinisten des Machbaren einen wertvollen Beitrag, indem sie im Rahmen des Projekts Europa weder Überflieger noch Tiefstapler, weder Träumer noch Skeptiker außer Acht lassen.
Würde man die Zukunftsorientierung Europas von der Montanunion bis zum Euro und (hoffentlich demnächst) einem Corona-Aufbaufonds entlang der Zeitachse nachzeichnen, dann würde dabei eine durch die Dekaden mäandernde Kurve herauskommen. Die Initiatoren des Einigungswerks hatten eine klare Vision von der Zukunft, die auf Völkerverständigung, Frieden und der gemeinsamen Entwicklung neuer Technologien (konkret der zivilen Kernkraft) abzielte.
. . . was sie einmal war
Diese Vision wurde im Laufe der Nachkriegsjahrzehnte sukzessive durch ein neues Leitbild ersetzt: nämlich das einer primär auf ökonomischer Integration basierenden Gemeinschaft. Der Höhepunkt dieser binnenmarktzentrierten Sicht war die Gründung der Eurozone im Jahr 1999. Das Zeitalter der großen Zukunftsentwürfe ging mit der Einheitswährung allerdings (vorerst?) zu Ende: Der Europäische Konvent, der der Union eine Verfassung geben wollte, scheiterte 2005 am Nein der Bürger Frankreichs und der Niederlande. Und seit 2008 ist die EU vor allem damit beschäftigt, Krisen zu managen. Angesichts der dramatischen Gegenwart bleibt für Gedanken an die Zukunft wenig Raum – einer Zukunft, die ohnehin nicht so rosig werden dürfte, wie man sich das nach dem Ende des Kalten Krieges ausgemalt hat.
Heißt das, dass die EU auf immer und ewig an den Krisenherd gekettet bleiben muss? Keinesfalls. Die Union ist nicht atrophiert, sondern nach wie vor zu Befreiungsschlägen fähig – sofern der Leidensdruck groß genug ist. Als auf dem Höhepunkt der Covidkrise der Zusammenhalt der EU-Mitglieder auf dem Spiel stand, entwarfen Deutschland und Frankreich die kühne Vision eines gemeinschaftlich finanzierten Hilfsfonds für die von der Pandemie besonders stark betroffenen Länder. Dieses Skelett einer Vision wurde seither mit Fleisch – konkret mit 750 Mrd. Euro – gefüllt. Und als Nebeneffekt dürften die Coronahilfen indirekt zur Vertiefung des europäischen Finanzmarkts führen.
Corona hat gezeigt, dass die EU nach wie vor Zukunft kann. Voraussetzung dafür ist allerdings das Engagement ihrer wichtigsten Mitglieder, um dem Vorhaben politischen Impetus zu verleihen. Dieser Impetus wird heute dringend benötigt, denn mit dem unkontrollierten und schwer kalkulierbaren Wandel des globalen Klimas steht Europa vor einer historisch beispiellosen Herausforderung. Sie zu meistern, wird viel Aufwand und viel Geld kosten – und internationale Koordination in bisher ungeahntem Ausmaß erfordern. Für diese Herausforderung ist kein Erdteil so gut gewappnet wie das umweltbewusste, wohlhabende, technisch versierte und in zwischenstaatlicher Kooperation geübte Europa.
Der Zeitpunkt, um konstruktiv an die Zukunft zu denken, ist jetzt. Denn das 22. Jahrhundert kommt schneller als man glaubt.