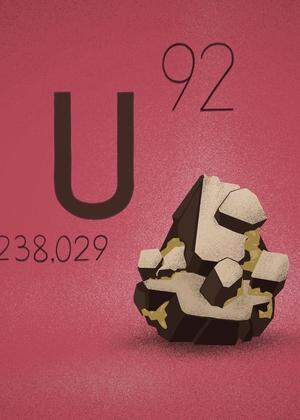Es tut sich etwas auf dem Gebiet der Kernfusionsforschung. Der Heilige Gral der Energieerzeugung ist – so scheint es – in den vergangenen Jahren um einiges nähergerückt. Vor allem der aktuelle Bau des gigantischen Fusionsreaktors Iter in Frankreich nährt die Hoffnungen auf eine Lösung der Energiefrage in der Zukunft. Mittendrin statt nur dabei sind Forschungsteams aus Österreich.
Von Michael Stadler und Florian Zsifkovics
Als Universitätsprofessor Friedrich Aumayr 2013 neuer Direktor des österreichischen Kernfusionsforschungsprogramms wurde, titelte die Technische Universität Wien (TU) auf ihrer Homepage: „Wir bauen eine Sonne!“ Diese Vision klingt absurd, ist in der Theorie aber genial. Durch die Verschmelzung von Wasserstoffatomen soll fast unerschöpflich viel Energie gewonnen werden – so wie es auch im Inneren der Sonne geschieht. Und das Ganze wäre möglich, ohne Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen, die Umwelt zu verschmutzen oder auf Jahrtausende strahlendem Müll sitzen zu bleiben.
Der TU Wien allein ist die Umsetzung der Simulation der Sonne mittels Atomfusionsreaktors jedoch einige Nummern zu groß. Für das, laut Aumayr, „gewaltigste Energieprojekt der Menschheitsgeschichte“ war und ist eine weltweite Zusammenarbeit zahlreicher Nationen nötig. Unter dem Namen Iter (Englisch für International Thermonuclear Experimental Reactor; Lateinisch für Weg) wird im südfranzösischen Cardarache gerade ein Versuchskernfusionsreaktor gebaut.
Eine Reihe österreichischer Forschungsgruppen aus Wien, Innsbruck, Salzburg, Leoben und Graz ist an Iter beteiligt. Neben der Koordination der einzelnen Gruppen kümmert sich Aumayr insbesondere um seine eigene Forschungsgruppe: jene für Atom- und Plasmaphysik. „Es ist beeindruckend, was wir in den vergangenen Jahren in unserem kleinen Land mit 30 bis 40 Leuten geschafft haben“, schwärmt der Leiter des Instituts für Angewandte Physik an der TU Wien.
In der "Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift" ("ÖIAZ") nannte er im Mai 2020 etwa eine von der TU Wien entwickelte und mittlerweile weltweit verwendete Messmethode in Bezug auf Fusionsplasma. Außerdem flossen Forschungsergebnisse der TU Wien betreffend die Plasma-Wand-Wechselwirkung und Materialien für Fusionsmagnete in den internationalen Know-how-Pool von Iter. Apropos Plasma: Dieses muss bei der Kernfusion aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium auf mindestens 100 Millionen Grad Celsius aufgeheizt werden – das ist zehnmal heißer als im Kern der Sonne.
Magnetfeld verhindert Schäden
Damit die Hitze keine Schäden am Reaktor verursacht, wird das Plasma in ein Magnetfeld eingeschlossen und soll somit nicht direkt mit der Wand des Kernfusionsreaktors in Berührung kommen. „Aber das funktioniert nicht perfekt“, sagt Paul Szabo, Doktorand in Aumayrs Arbeitsgruppe der Atom- und Plasmaphysik. „Es gibt immer wieder Teilchen, die aus diesem Magnetfeld ausreißen und gegen die Wand prallen. Dort finden dann Erosionen statt. Diese Effekte sind das, was wir messen. Das Ziel ist es, Daten zu liefern, um herauszufinden, welche Materialien man für Kernfusionsreaktoren nützen soll. Für die Zukunft ist das noch ein ungeklärtes Problem.“
Bei Iter ist die Entscheidung über die verwendeten Materialien schon gefallen. Wird der Forschungsreaktor aber erst einmal in Betrieb genommen, sollen vor Ort in Frankreich weitere Erkenntnisse gezogen werden. Als übergeordnetes Ziel will Iter zeigen, dass ein Kernfusionsreaktor über längere Zeit genug Energie erzeugen kann, um ein fusionsfähiges Plasma aufrechtzuerhalten. Dies wäre ein Meilenstein auf dem Weg dahin, Kernfusion kommerziell zu betreiben.
Die aktuellen Forschungen der TU Wien zielen im Grunde schon auf das Nachfolgeprojekt von Iter ab: Demo (Demonstration Power Plant). „Jetzt forscht man eher schon dafür“, sagt Aumayr. Denn während die Technologien für Iter schon über die Forschungs- und Planungsphase hinaus sind und sich bereits in der Konstruktionsphase befinden, sei bei Demo von der Planung her noch alles möglich. Sogar ein anderer Reaktortyp. Bei Iter wird ein sogenannter Tokamak verwendet. Inzwischen werden aber auch beim weniger gut erforschten Stellarator gute Ergebnisse erzielt.
Bei beiden Reaktorvarianten wird Plasma mit einem Magnetfeld im Zentrum eines Raums gehalten.
Beim Tokamak (Abkürzung für Toroidale Kammer in Magnetspulen; übersetzt aus dem Russischen) wird aber zusätzlich Strom durch das Plasma geleitet. Die Stromzufuhr wird kontinuierlich gesteigert, wodurch das elektromagnetische Induktionsfeld fortbesteht. Würde man die Stromzufuhr nicht steigern, würde das Feld zusammenbrechen. Da man aber nicht ins Unendliche steigern kann, arbeiten Tokamaks pulsweise. Das heißt, der Strom wird immer wieder unterbrochen und neu zugeführt.
Stellaratoren (Lateinisch stella = Stern) errichten das Magnetfeld dagegen komplett durch umliegende Spulen, wodurch das Plasma nicht unter Strom gesetzt werden muss. Theoretisch sind Stellaratoren für den Dauerbetrieb sehr gut geeignet, weil sie unterbrechungsfrei arbeiten können.
Materialien müssen billiger werden
Generell sind die Möglichkeiten zur Erzeugung von Energie mittels Kernfusion aus physikalischer Sicht laut Aumayr „praktisch gelöst“. Aus technologischer Sicht gilt es jedoch, noch Arbeit zu investieren, „um die Vorgänge bei den Experimenten im Labor auch in viel größeren Dimensionen beherrschen zu können“. Bis 2029 soll so viel Vorarbeit geleistet werden, um ein erstes Design für Demo auf dem Papier zu haben. Was Demo von Iter unterscheiden soll? „Es setzt seinen Fokus auf die Wirtschaftlichkeit von Kernfusion“, erklärt Christian Cupak, ein weiterer Doktorand im Team von Aumayr. Dementsprechend müssen die Materialien, die für Reaktoren verwendet werden, billiger werden, als sie es jetzt bei Iter sind.
Die geschätzten Kosten von Iter sind inzwischen auf rund 20 Milliarden Euro angewachsen. Gepaart mit der jahrzehntealten Prognose, dass mit Kernfusionskraftwerken in etwa 30 Jahren zu rechnen sei, hat das viele Kritiker auf den Plan gerufen. Von einem Milliardengrab will Aumayr jedoch nichts wissen. „Fusion ist eine Option, die man sich erhalten sollte“, sagt er und zieht einen Vergleich zu den Kosten von erneuerbarer Energie: „2019 hat allein die Abgabe für erneuerbare Energie in Deutschland 26 Milliarden Euro betragen.“ Ein weiteres Beispiel: Im selben Jahr gaben die USA für das Militär rund 602 Milliarden Euro aus.
Die 20 Milliarden Euro für Iter werden zudem von einer großen Anzahl an Ländern getragen, wobei die Europäische Union etwa 60 Prozent davon übernimmt. Und Aumayr gibt zu bedenken, dass die Länder nicht direkt Geld einzahlen müssen, sondern „meistens In-Kind-Leistungen“ tätigen. Heißt: „Die Russen liefern zum Beispiel eine Spule von bestimmtem Wert, die Europäer bauen die Gebäude.“ Aufträge an die Industrie werden in den jeweiligen Ländern beziehungsweise im Fall der EU im gemeinsamen Wirtschaftsraum ausgeschrieben. Die Fördergelder der EU werden in der österreichischen Kernfusionsforschung hauptsächlich zur Anstellung von etwa 20 Doktoranden verwendet. „Das Hauptaugenmerk bei uns ist die Ausbildung“, sagt Aumayr. „Wir versuchen, das Know-how aufrechtzuerhalten. Wenn Iter in Betrieb ist, wollen wir eine Betriebsmannschaft stellen können.“

Neben den technischen Problemen stellt „die gesellschaftliche Akzeptanz“ von Forschung über Kernfusion als neue Energiequelle „sicher eine Herausforderung dar“, sagt Doktorand Szabo. Denn: „Kernfusion wird oft mit Kernspaltung gleichgesetzt und ist dann dementsprechend negativ besetzt.“ So hat sich etwa die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.
Weshalb Kernfusion in Zukunft eine wichtige Rolle spielen kann? Damit beschäftigt sich eine eigene Forschungsgruppe in Österreich. Sie erstellt sozioökonomische Studien und stimmt auch mit allen Experten rund um den Globus überein: Der weltweite Energiebedarf wird deutlich ansteigen. „Bei uns wahrscheinlich nicht mehr viel, aber aus der Sicht der zweiten und dritten Welt besteht ein enormer Aufholbedarf“, erklärt Aumayr. Ab der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts könnten Kernfusionskraftwerke ihm zufolge einen „substanziellen Beitrag“ leisten. Auch wenn sie allen voran erneuerbare Energiequellen nicht ablösen dürften: „Wir brauchen alles, einen richtigen Energiemix.“ Die Fusion würde dabei den Sockel bilden und bis zum Ende des Jahrhunderts etwa 20 bis 30 Prozent des Energiebedarfs decken.
Der Umweltfaktor
Ein wichtiges Argument für die Forschung an der Kernfusion als Energie ist der Umweltfaktor. So sollen damit klimaschädliche Kraftwerke, die Kohlenstoffdioxid (CO2) produzieren, und „schmutzige Kernspaltungskraftwerke“ (Aumayr) ersetzt werden. Bei der Kernfusion entstehen keine Treibhausgase und vergleichsweise wenig radioaktiv verstrahlter Müll. Die Wände des Reaktors werden im Fall von Iter mit einer Deuterium-Tritium-Reaktion zwar auch aktiviert, mit einem speziell entwickelten Stahl als Material kann eine langlebige Aktivierung aber geringgehalten werden. Statt eines Endlagers reicht dann ein Zwischenlager. „Nach 30 bis 100 Jahren ist der radioaktive Abfall wieder angreifbar“, verspricht Aumayr. Anders als Kernspaltungskraftwerke sind Kernfusionskraftwerke für den Physiker „nicht gefährlich“. Der für die Fusionsreaktion notwendige Brennstoff aus Deuterium und Tritium wird schrittweise in sehr kleinen Mengen nachgefüllt. Die Folge: Es kommt zu keiner Reaktion, die außer Kontrolle geraten könnte. Die Fusion würde bei der kleinsten Störung einfach stoppen. Ein weiterer Vorteil der Kernfusion steckt in der benötigten Menge der Ausgangsprodukte Deuterium und Tritium.

Zum Vergleich: Ein Gigawatt (elektrisch) entspricht der jährlichen Leistung eines unterdurchschnittlichen Kernspaltkraftwerks in Deutschland (Topwert 2019: Isar 2 mit 1,49 Gigawatt – damit werden etwa 3,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgt).
Ein zentrales Problem bezüglich der Ausgangsprodukte für die Kernfusion gilt es allerdings noch zu lösen: Tritium kommt in der Natur kaum vor. Künstlich erzeugt wird es bei der Kernspaltung in Schwerwasserreaktoren. Von diesen gibt es jedoch immer weniger, und das Ziel von Kernfusionskraftwerken sei es ja, Kernspaltkraftwerke abzulösen. Für den Dauerbetrieb von Fusionskraftwerken hoffen die Wissenschaftler nun, Tritium direkt im Fusionsreaktor erbrüten zu können. „Das wird bei Iter in einem sogenannten Blanket getestet“, verrät Aumauyr. Doktorand Cupak meint: „Die Forschung ist durchaus zuversichtlich.“
Kritiker wie Michael Dittmar, Physiker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), bleiben skeptisch. Die Vorstellung, dass das Brüten von Tritium gelingt, basiere auf nichts anderem als auf „Hoffnungen, Fantasien, Missverständnissen oder sogar bewussten Falschdarstellungen“, schrieb Dittmar in einem Gutachten, das er 2019 im Auftrag der Fraktion der Grünen im Deutschen Bundestag verfasst hat. Genau hier zeigt sich die Bedeutsamkeit von Iter als Forschungsreaktor, dessen Ziel es nicht ist, Strom-, sondern Erkenntnisse zu liefern. Immerhin das Zehnfache an investierter Energie (Q=10) soll Iter schon produzieren können. Im Gegensatz zu Tritium ist Deuterium, das zweite wichtige Ausgangsprodukt der Kernfusion, fast unbegrenzt vorhanden. „Man kann es praktisch aus Meerwasser herausfiltern“, sagt Cupak.
Start-ups machen Konkurrenz
Iter ist zwar das mit Abstand größte, jedoch bei Weitem nicht das einzige Projekt, das sich dem Heiligen Gral der Energieerzeugung nähern will. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hat China Anfang Dezember 2020 den Reaktor Tokamak-HL-2M in Betrieb genommen. In Japan wurde – in Kooperation mit Europa – vor Kurzem die Tokamak-Fusionsanlage JT-60SA fertiggestellt. Deutschland verfügt mit Wendelstein-7-X über den größten Reaktortyp eines Stellarators weltweit. Und die USA? Deren Rolle sei „zumindest was die magnetische Fusion anbelangt, relativ klein“, sagt Aumayr. Der Fokus liege mehr auf dem Trägheitsfusionsprogramm, das „eher in Waffenlaboratorien durchgeführt wird“.
Eine nicht zu unterschätzende Rolle im Wettlauf um die Kernfusion spielen dagegen Start-ups, die die großen staatlichen Projekte herausfordern. Commonwealth Fusion Systems (CFS), eine Gruppe von ehemaligen Mitarbeitern der Elite-Uni MIT in Cambridge, finalisiert gerade ihre Pläne für den Reaktor Sparc. Kleiner und günstiger als Iter soll er sein, aber trotzdem ähnliche Performance liefern. In nicht mehr als 15 Jahren soll der Prototyp kostengünstigen Strom in den USA produzieren. Weitere Start-up-Projekte sind inzwischen das Investitionsziel zahlreicher Tech-Milliardäre wie Amazon-Chef Jeff Bezos (Gereral Fusion). Prinzipiell steht Aumayr einer belebenden Konkurrenz positiv gegenüber: „Es sind durchaus clevere Ideen und andere Zugänge dabei.“ Die Mehrheit der Start-up-Ziele hält er jedoch für nicht realisierbar. Denn diese Projekte hätten einen großen Nachteil: „Sie haben den Schritt vom kleinen Experiment zur großen Anlage noch nicht geschafft.“
Wettlauf ins All 2.0?
Ein wenig erinnert der Wettlauf zur Kernfusion mit all den konkurrierenden Nationen ein wenig an den Wettlauf ins All in den 1950er- und 60er-Jahren. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied, sagt Cupak: „Damals war das mehr ein Prestigeprojekt zwischen den USA und der Sowjetunion. Bei der Kernfusion geht es aber um die Klärung wesentlicher technischer Fragen für die Zukunft. Ich glaube, da hat man ein ziemlich alternatives Modell mit Kooperationen wie Iter gefunden.“
Es ist möglich, Iter schon jetzt als Baustelle zu besuchen. „Ich kann jedem raten, sich eine Führung geben zu lassen. Die ganze Anlage ist unheimlich beeindruckend“, schwärmt Aumayr. Er hat auch einen wichtigen Tipp parat: „Reisepass mitnehmen!“ Denn das Projekt findet auf exterritorialem Gebiet statt.
Was ist der Unterschied zwischen Kernfusion und Kernspaltung?
Kernspaltung und Kernfusion zwei Worte, die eine Ähnlichkeit haben und doch so unterschiedlich sind. Doch wo liegt der genaue Unterschied zwischen den beiden Formen?
Der wohl wesentlichste Unterschied zwischen beiden Formen ist die Auswahl der Atome. Während die Kernspaltung vor allem schwere Atome wie Strontium und Barium braucht, um überhaupt funktionieren zu können, ist es bei der Kernfusion komplett anders. Denn die Fusion gelingt vor allem mit leichten Atomen wie Wasserstoff. Während die Ressourcen bei der Kernspaltung endlich sind, kann die Fusion so gesehen unerschöpflich betrieben werden. Das hätte gegenüber der Uranspaltung einen großen Vorteil: Ein Super-Gau ist wie bei einem Atomkraftwerk ausgeschlossen, dazu nämlich hätte ein Fusionsreaktor viel zu wenig Energie gespeichert. Auch würde weniger Atommüll anfallen und somit die Frage der Lagerung entschärft werden.