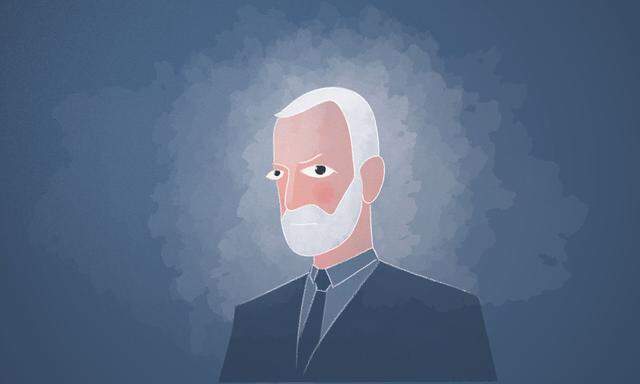Die Couch, auf der man sich die Sorgen von der Seele redet, ist bei Weitem nicht die einzige Methode in der modernen Psychotherapie. Dennoch könnte das Bild des bequemen roten Sofas den in früheren Zeiten mitunter wenig zimperlichen Umgang mit psychisch Kranken überlagern. Auch heute ist die Entwicklung der Psychotherapie längst nicht abgeschlossen, unter anderem trugen einige österreichische Therapeuten zu einer wesentlichen Verbesserung der Behandlungsmethoden bei.
Die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Psyche geht bis in die Steinzeit zurück. Damals kümmerten sich Schamanen um geistige Leiden. „In dem Moment, in dem sich das menschliche Bewusstsein entwickelt hat, wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, ist das Reflektieren über das, was früher Instinkte waren, über Ängste und Bedürfnisse entstanden“, sagt die Lehrtherapeutin Susanne Pointner.
Im alten Ägypten und in Mesopotamien übernahmen Priester psychotherapeutische Kompetenzen. „Religion wurde als Instrument angesehen, das Heilung durch göttlichen Beistand bringt. Auch im katholischen Glauben galten Priester lang als eine Art von Psychotherapeuten. Heilige wurden angerufen und Pilgerreisen aufgenommen, um geheilt zu werden“, sagt Pointner. Als Resultat eines Missverhältnisses der Körpersäfte sah dagegen der griechische Arzt Hippokrates psychische Störungen an und verwendete noch heute gängige Begriffe wie Manie und Melancholie, um diese Zustände zu beschreiben. „Das sogenannte finstere Mittelalter war aus psychotherapeutischer Sicht gar nicht so finster. Psychisch Kranke wurden zwar nicht gut behandelt, aber auch nicht ausgestoßen. Erst durch den Aufstieg von Bürgertum und Handel sollte sich das ändern. Damals hat man alles, was krank, dunkel und verboten war, auf psychisch Kranke projiziert“, erklärt Pointner.
Narrentürme und ihre Folgen bis heute
Durch die zunehmende Unterdrückung der persönlichen Freiheit im Absolutismus wurde die Schlechterstellung von Menschen mit psychischen Erkrankungen verstärkt. Alles, was der ökonomisch ausgeprägten Denkrichtung widersprach, wurde angeprangert. Die Psychotherapeutin berichtet über das Ausmaß dieses Vorgehens: „Psychisch Kranke wurden in Narrentürmen eingesperrt und in Gefängnissen bei völliger Dunkelheit angekettet. Mit bestrafenden Aktionen wie Bädern in kaltem Wasser wurden Symptome unterdrückt.“ Das habe dazu geführt, dass die Betroffenen psychosomatische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen anstelle ihrer vorherigen hysterischen Anfälle bekamen, sagt Pointner und setzt fort: „Wenn jemand nicht in den Narrenturm gekommen ist, hat er bestenfalls einen Aderlass erhalten, für einen Ausgleich der Säfte. Von psychotherapeutischer Behandlung war, außer durch Bestrafungsmethoden, kaum die Rede.“
„Die Folgen der Narrentürme und der Folter von psychisch Kranken wirken bis heute nach“, sagt Pointner im Hinblick auf die Epigenetik des Menschen: „Epigenetisch werden in unserem Gehirn Erfahrungen über Generationen hinweg gespeichert. Bei Menschen mit hoher Sensitivität ist die Möglichkeit gegeben, dass einer ihrer Vorfahren eine traumatisierende Erfahrung in einer Behandlung oder einem Versuch der Bekehrung gemacht hat. Diese frühen Erfahrungen sitzen uns noch immer ein bisschen in den Zellen“, erklärt Pointner.

Die „Wiener Psychotherapie“ macht Schule
Um 1800 behandelte der österreichische Arzt Anton Mesmer psychisch Kranke mittels Magnetismus. Dabei sollte eine physikalisch gedachte Lebenskraft in den Patienten erweckt oder besser verteilt werden. Eine wissenschaftliche Kommission, der auch der amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin angehörte, kam jedoch zu dem Schluss, dass dieses „magnetische Fluidum“ nicht existiert und die Wirkung dieser Methode nur auf einem Placeboeffekt beruht. Der Begriff Psychotherapie wurde um 1870 in England geprägt. 30 Jahre später sollte ein österreichischer Arzt die Grundlagen für die Psychotherapie als moderne Wissenschaft legen.
Sigmund Freud gilt mit der von ihm begründeten Psychoanalyse als Ausgangspunkt der modernen Psychotherapie. Pointner, die an der Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU) lehrt, beschreibt dessen revolutionären Ansatz wie folgt: „Freud hat als Erster versucht, die menschliche Psyche mit naturwissenschaftlichen Begriffen zu erklären und daraus logische, transferierbare Regeln für die Behandlung abzuleiten. Etwa: ‚Wenn man Menschen behandeln will, muss man sie auf die Couch legen und darf keinen Blickkontakt zu ihnen haben.‘ Auch heute noch gibt es die klassische Psychoanalyse, die so angewandt wird. Oft wird sie aber im Sitzen mit Blickkontakt durchgeführt.“

Inhaltliche Diskrepanzen zwischen Freud und einigen seiner Kollegen führten ab 1911 zu einer vielfachen Ausdifferenzierung der Psychotherapie. Eine davon, die Individualpsychologie, wurde von Freuds Kollegen, dem Wiener Psychotherapeuten Alfred Adler, begründet. In der Individualpsychologie wird die Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen als zentral für die menschliche Entwicklung angesehen und somit eine andere Auffassung zur Entstehung von Minderwertigkeitsgefühlen und Neurosen vertreten als von Freud, der äußerliche Einflüsse, wie ausbleibendes Stillen oder Vernachlässigung der Kinder, dafür verantwortlich sah.
Über ihr eigenes Schaffen hinaus wirkten Freud und Adler durch einige ihrer Schüler auf die weitere Etablierung der Psychotherapie als Wissenschaft. Carl Rogers, der die Gesprächstherapie begründete, die nicht auf die Probleme der Patienten fokussiert, sondern auf deren Entwicklungspotenzial, war ein Schüler des Freud-Schülers Otto Rank. Rank setzte sich unter anderem mit psychischen Folgewirkungen der Geburt auseinander. Auch der Wiener Viktor Frankl, der die Logotherapie und Existenzanalyse begründete, stand in persönlichem Kontakt zu Freud und Adler. Grundannahme der Logotherapie und Existenzanalyse ist, dass die Suche der Menschen nach Sinn im Leben ihre hauptsächliche Motivationskraft darstellt.
Wiens Stellenwert für die Psychotherapie wird auch dadurch deutlich, dass die drei Richtungen der Tiefenpsychologie (Psychoanalyse, Individualpsychologie, Existenzanalyse) als „Wiener Schulen“ bezeichnet werden. Während der NS-Zeit mussten jedoch viele jüdische Psychoanalytiker, wie Freud, Wien verlassen. Andere, wie Frankl, wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht. Frankl überlebte vier Konzentrationslager und schilderte danach seine Erlebnisse während der Inhaftierung in „… trotzdem Ja zum Leben sagen“. Die Psychotherapeutin Pointner zieht aus der Erkenntnis, selbst in widrigsten Umständen einen Sinn im Leben zu sehen, in abgeschwächter Form Parallelen zu heute: „Gerade vor dem Hintergrund aktueller Krisen, wie der Pandemie, erscheint Frankls Rückbesinnung auf das, worum es wirklich im Leben geht, höchst aktuell. Die Menschen sollen sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden und dass es nicht nur um die Selbstverwirklichung im Sinne eines Lustprinzips geht.“
Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten sich neben der Psychoanalyse weitere psychotherapeutische Methoden. „Unter anderem das Psychodrama, die Individualpsychologie, die Systemische Psychotherapie und die Verhaltenstherapie, deren Fokus darauf liegt, Gedanken und Gefühle, die Leidenszustände verursachen, aufzuspüren und zu verändern“, sagt Barbara Haid, Präsidentin des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP). Die Grundhaltung der humanistischen Psychotherapieschulen, die sich zum Teil als „Gegenentwurf“ zu Psychoanalyse und Verhaltenstherapie verstehen, liegt darin, „dass der Mensch noch mehr im Mittelpunkt gesehen wird. Psychotherapeut und Patient begeben sich gemeinsam auf die Suche nach dem Unbewussten und Unbekanntem“, sagt Haid. Derzeit gibt es vier große Richtungen, denen sich die 23 in Österreich anerkannten Psychotherapie-Methoden zuordnen lassen.

Zwischen Eingliederung und Eigenständigkeit
150 Jahre nach ihrer Begründung steht die moderne Psychotherapie am Scheideweg. Im Zuge einer Novellierung des Psychotherapie-Gesetzes soll die Psychotherapieausbildung auf ein akademisches Niveau gehoben werden. Psychotherapeutin Pointner erachtet es dabei für wichtig, dass die etablierten Ausbildungsinstitutionen die neue Ausbildungsform, in Kooperation mit den Universitäten, mitgestalten. „Die Ausbildungsvereine sind die Hüter des Schatzes, sie haben das psychotherapeutische Wissen entwickelt, beforscht, gelehrt. Mit der Würdigung der Psychotherapie-Wissenschaft als eigenständiges Studium würde die Hemmschwelle der Menschen niedriger, sich in Behandlung zu begeben, so als ob man zum Arzt geht.“ Ein weiteres Zukunftsszenario könnte die integrative Psychotherapie sein. „Dabei wird versucht, Elemente verschiedener Methoden zu einer übergeordneten Psychotherapie zu formieren“, sagt ÖBVP-Präsidentin Haid. Jedoch betont sie, dass die geeignetste Psychotherapieform immer die sei, die am besten zu den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten passe.
In welche Richtung sich die Psychotherapie entwickeln wird, wird sich zeigen. Digitale Technologien könnten zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Bis vor der Pandemie war es etwa verboten, Therapiesitzungen online abzuhalten. Doch egal, in welcher Form die Psychotherapie weiterbestehen wird, gebraucht wird sie mehr denn je. Allein im vergangenen Jahr litten, gemäß Zahlen der österreichischen Sozialversicherung, 900.000 Österreicherinnen und Österreicher, das entspricht zehn Prozent der Gesamtbevölkerung, an psychischen Erkrankungen.