75 Jahre Israel. Wie wurde eine beinahe tote Sprache mit biblischem Vokabular zur Grundlage für heutige Plaudereien im Alltag, Amtswege, Einkäufe und vor allem auch Literatur? Ein Blick auf das Hebräische, die israelische Nationalsprache.
Es gibt viele Wörter, die beschreiben, was im vergangenen Jahrhundert mit dem Hebräischen passiert ist. Mit der biblischen Sprache, die das jüdische Volk rund 1700 Jahre nur auf dem Papier begleitete. Die beinahe tot war, wie Latein. Und dann in einem enormen Willensakt zur Staatssprache gemacht wurde, die jeder sprechen sollte. Die das verbindende Element der Israelis wurde. „Die Wiedergeburt einer Sprache“, nennen es die einen, „ein Wunder“ sagen andere. Etgar Keret, prominenter israelischer Autor, nutzt eine Küchenmetapher: Das Hebräische sei lang eingefroren gewesen. Und dann „in die Mikrowelle gestellt und aufgetaut worden“.
Tatsächlich gibt es wenig Vergleichbares. Wörter aus fast zwei Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte mussten aus den Wurzeln der alten Sprache nachgebildet werden. Basierend auf biblischen Ausdrücken, die mit dem täglichen Leben wenig zu tun hatten. Das sei, als ob man im Deutschen einen Satz von Schiller mit Rap kreuzen würde, sagt Keret. Wie gelang die Wiederbelebung des Hebräischen?
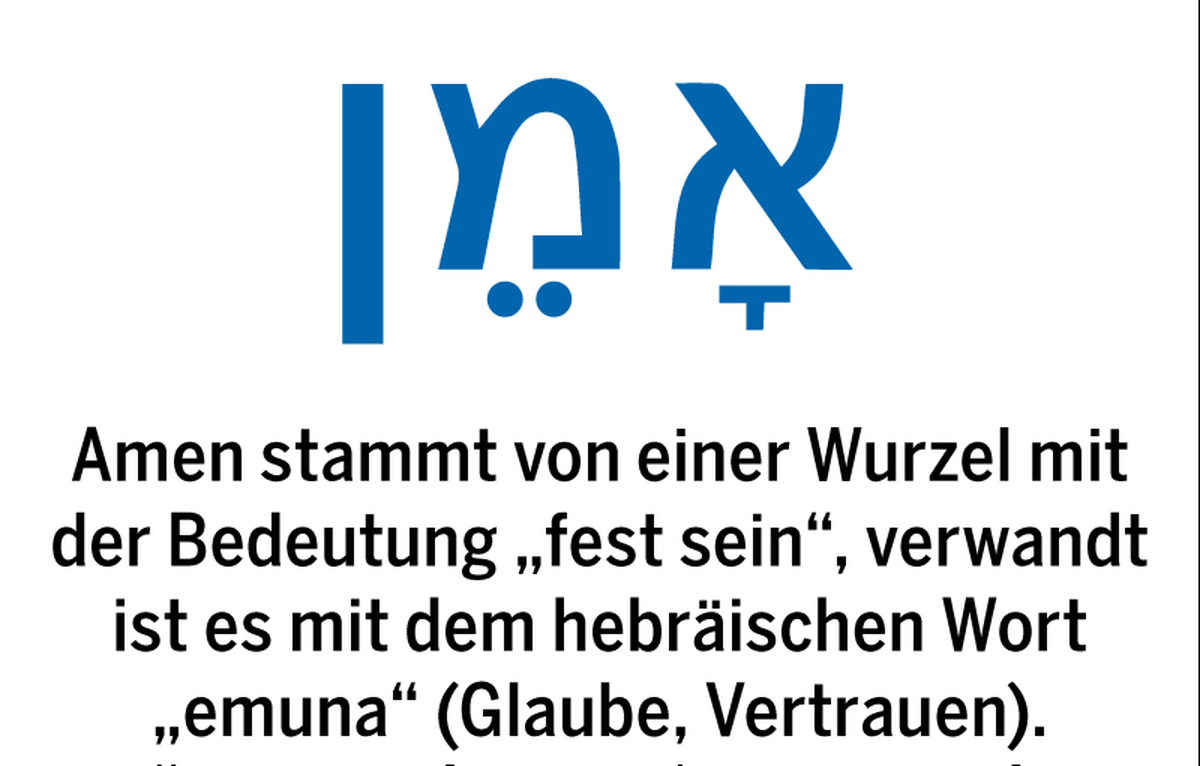
Zu Beginn stand ein kollektives Improvisieren, eingeläutet von Menschen wie Mendele Moicher Sforim, auch Mendele der Buchhändler genannt, der vor rund hundert Jahren starb. Er hatte in Osteuropa gelebt und auf Jiddisch geschrieben. Einer eher ärmlichen Sprache, auf die jüdische Aufklärer, wie Mendele einer war, herunterschauten. Juden nutzten meist drei Sprachen: Hebräisch als Sprache der Religion, Jiddisch oder Ladinisch als Umgangssprache, um sich etwa Eier vom Nachbarn zu borgen. Und dann noch die jeweilige Landessprache.
Mendele brachte nun das Jiddische mit seinen Volksstücken auf ein literarisches Niveau. Wobei die Sprache, deren Basis das Mittelhochdeutsche ist, später kaum mehr literarisch verwendet wurde – mit Ausnahme etwa von Nobelpreisträger Isaac Singer. Der Erneuerer Mendele jedenfalls schuf eine Basis für Jiddisch, aber vor allem auch für das Hebräische, in Israel „Ivrit“ genannt.
Als er sich nämlich für den Zionismus zu interessieren begann, übersetzte er seine Volksstücke in die zuvor stumme Sprache. Übertrug Redewendungen aus dem biblischen Kontext auf Tagesfragen, kreierte einen wilden Mix aus unterschiedlichen Sprachschichten. Mit dem Ziel, einen „hebräischen Stil“ zu schaffen, „ein lebendiges Wesen, das klar und deutlich spricht, wie es Menschen hier und heute tun“. Die Sprache wurde lebendig, mithilfe vieler. 1921 wurde Hebräisch in Palästina eine der drei Landessprachen, mit der Gründung des Staats Israel 1948 alleinige Amtssprache.
Ein Erfolg, aber nicht nur: Die verschiedenen Einwanderer brachten ihre Kulturen mit, die Sprachen, in denen sie über ihre Gefühle, ihre Probleme, ihr Leben reden konnten. Und hatten oft genug Probleme mit dem hebräischen Ideal: „Die Einführung brachte auch viel menschliches Scheitern mit sich – und viel Sprachlosigkeit“, erzählt die vielfach ausgezeichnete Übersetzerin Anne Birkenhauer im „Presse“-Gespräch. Als junge Frau ging sie in den Achtzigern nach Israel und erst dort lernte sie Ivrit.




