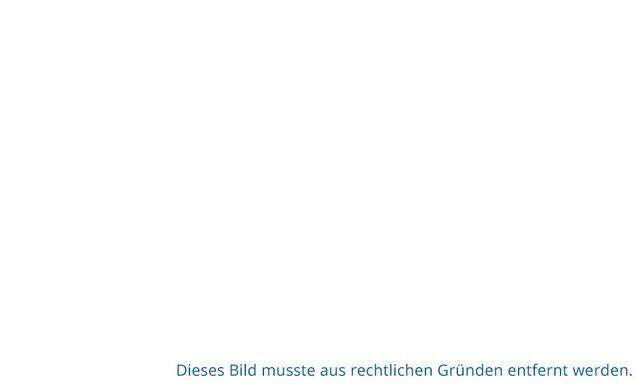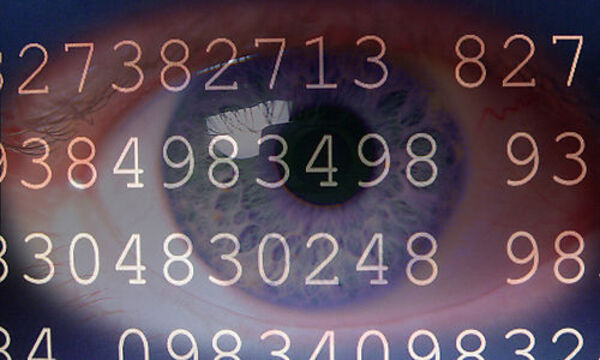SERIEAb 1. April wird aufgezeichnet, wer wann mit wem telefoniert oder SMS schreibt. Schon bisher hatten Ermittler aber viele Maßnahmen zur Verfügung.
"Ich habe manchmal den Eindruck, wir werden ähnlich stark überwacht wie seinerzeit die DDR-Bürger von der Stasi." Starke Worte, die der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshof, Karl Korinek, bereits im Jahr 2007 tätigte. Nun ist es 2012 und ab 1. April gewinnen die Behörden mit der Vorratsdatenspeicherung die nächste Möglichkeit, die Bevölkerung zu überwachen. Doch schon bisher hatten Ermittler einige Mittel in der Hand, um umfassende Profile über verdächtige Personen zu erstellen. DiePresse.com bietet einen Rückblick über die Maßnahmen, die bereits gesetzlich verankert sind und angewendet werden.
Der große Lauschangriff
Im Jahr 1997 wurde in §136 der Strafprozessordnung die "optische und akustische Überwachung von Personen" geregelt. Sie wird gestattet, wenn etwa dringende Gefahr besteht, dass eine Person entführt wird. Aber auch die Aufklärung von Verbrechen mit mehr als zehn Jahren Freiheitsstrafe rechtfertigt einen Lauschangriff. Umstritten ist die Ergänzung, dass die Überwachung auch bei den Tatbeständen der "kriminellen Organisation" oder "terroristischen Vereinigung" (§278a und §278b Strafgesetzbuch) gestattet wird. Unter ersterem wurden etwa Tierschützer des Vereins gegen Tierfabriken angeklagt, was zu heftigen Protesten führte. Die allererste Überwachung mit einem Lauschangriff wurde im Mai 1999 angeordnet. Bei der umstrittenen "Operation Spring" sollte organisierten Drogendealern das Handwerk gelegt werden.
Rasterfahndung
Diese Methode filtert Personen nach bestimmten Kriterien, die einem vorher angefertigten Täterprofil gleichen. Entwickelt in den 1970er-Jahren im Kampf gegen die terroristische Rote Armee Fraktion (RAF) in Deutschland, ist die Rasterfahndung ebenfalls seit 1997 in Kraft. Eingesetzt wurde die Methode, bei der Datenbestände unterschiedlicher Quellen vernetzt durchsucht werden sollen, bisher aber nicht. Selbst im Fall Julia Kührer wurde die Rasterfahndung nicht eingesetzt. Ein Kuriosum: Exakt an dem Tag als die Rasterfahndung erlassen wurde, wurde der Briefbombenattentäter Franz Fuchs verhaftet. Allerdings nur, weil er selbst sich bei einer Kontrolle auffällig benommen hatte.
Erweiterte Gefahrenforschung
Die "erweiterte Gefahrenforschung" (eine rein österreichische Wortschöpfung) wurde in §21 SPG (Entwurf als PDF) im dritten Absatz stark erweitert. Ermittler werden ermächtigt, Personen zu überwachen, die "sich öffentlich oder in schriftlicher oder elektronischer Kommunikation für Gewalt gegen Menschen, Sachen oder die verfassungsmäßigen Einrichtungen" aussprechen. Gleiches gilt für Personen, die sich Mittel beschaffen, um "Sachschäden in großem Ausmaß oder die Gefährung von Menschen" herbeiführen. Diese etwas schwammigen Formulierungen waren Grund für heftige Kritik. Wenn sich jemand ein paar Kanister mit Benzin kauft und Streichhölzer besitzt, hat er selbst auch "Mittel und Kenntnisse", um theoretisch große Schäden anzurichten. Ein weiterer Teil des §21 Abs.3 SPG sieht vor, dass Gruppierungen, bei denen damit zu rechnen ist, dass sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, eine "Beobachtung" vorgesehen ist.
Computer-Überwachung
Im Oktober 2011 gab es heftige Kritik an der österreichischen Polizei. Das deutsche Unternehmen DigiTask hatte angegeben, dass die heimischen Ermittler Spionagesoftware des Anbieters erworben hätten. Das Innenministerium betonte aber, dass dieser "Bundestrojaner", der vollen Zugriff auf die Daten eines den Computer eines Verdächtigen ermöglicht, nicht eingesetzt wurde. Was aber sehr wohl bereits genutzt wurde, sind Programme, die Screenshots des Computers erstellen. Im Fall des "Austro-Islamisten" Mohammed M. wurden diese eingesetzt, um seinen Computer zu überwachen. Eigentlich wollten die Ermittler per Videokamera den Bildschirm filmen. Es gab aber in der Wohnung des Verdächtigen keine Möglichkeit, diese unbemerkt anzubringen.
Biometrische Daten
Umstritten ist, ob die Speicherung biometrischer Daten im Reisepass bereits als Überwachungsmaßnahme gilt. Fakt ist, dass österreichische Staatsbürger seit 30. März 2009 ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, wenn sie einen neuen Reisepass beantragen. Auch das Passfoto muss bestimmten Kriterien entsprechen, damit Personen digital erkannt werden können. All diese biometrischen Daten werden auf einem Chip gespeichert. Viele Länder, unter anderem die USA und Japan, verlangen bei der Einreise noch dazu eine separate Abgabe von Fingerabdrücken und eines Fotos. Österreich war aufgrund einer EU-Verordnung verpflichtet, bis spätestens 28. Juni 2009 die Fingerabdrücke in Reisepässe zu integrieren.
Verbindungsdaten schon jetzt genutzt
Alles, was unter dem Stichwort "Vorratsdaten" gespeichert wird, kann schon jetzt von Polizei und Staatsanwaltschaft von Providern ausgeforscht werden. Allerdings halten diese die Daten nur so lange vor, wie sie sie für die betriebliche Abwicklung benötigen. Wer wann mit wem telefoniert oder SMS geschrieben hat, wird also bereits jetzt ermittelt. Mit der Vorratsdatenspeicherung wird nun die Frist, wie lange diese Daten vorhanden sein müssen, auf sechs Monate festgelegt.
Serie Vorratsdatenspeicherung
Ab 1. April 2012 müssen Internet-, Telefon- und Mobilfunkbetreiber alle Verkehrsdaten ihrer Kunden anlasslos sechs Monate lang speichern. DiePresse.com informiert bis dahin mit einer Serie über die umstrittene Vorratsdatenspeicherung und ihre Auswirkungen.
(db)