Spargel
Zur Kulturgeschichte eines Stängels
Von den alten Griechen bis zu Erzherzog Ferdinands Diätplan - Spargel ist nicht nur reich an Inhaltsstoffen, er blickt auch auf eine reiche Geschichte zurück. Die besten Spargelrezepte finden Sie hier.

Der römische Zensor und Schriftsteller Cato nannte den Spargel "Blandimentum Gulae", den "Gaumenschmeichler". Damit bringt er auch einen frühen Vorgeschmack auf das heutige Amuse-Gueule. Die Geschichte des Spargels setzt aber früher an. Die besten Spargelrezepte finden Sie hier.
Imago

Ägyptische Grabfresken mit Abbildungen gebündelten Spargels sollen belegen, dass schon vor 5000 Jahren Spargel ein geschätztes Gemüse war. Weitere Beweise für solch einen frühen Auftritt fehlen allerdings, vielleicht waren doch nur ein paar gebündelte Holzstöckchen gemeint.
Imago

Wenn es die Ägypter nicht waren, wandert der Gral weiter zu den alten Griechen. Sie waren die ersten, die den Spargel nicht nur für sich entdeckten, sondern dies auch schriftlich belegen können. Der griechische Name "Asparagos" bedeutet übrigens Stiel oder junger Trieb.
Imago

Für die Griechen war der Spargel noch kein Gaumenschmeichler, wie bei den Römern, die ihn als erste kultivierten, sondern quasi ein Breitbandantibiotikum. Die ersten belegten Aufzeichnungen zum medizinischen Spargeleinsatz kamen von dem Arzt Hippokrates de Kos (ca. 560 – 370 v.Chr.). Er beschrieb ihn als harntreibendes Heilmittel. Spargel galt aber auch als Allroundmedizin gegen Zahnschmerzen, Rheuma bis hin zu Bienenstichen.
Reuters

Später im Mittelalter stand (z.B. in der "Hausz Apoteck, 1544) die abführende Wirkung des Spargels im Vordergrund. Für dem Lexikograf Johann Heinrich Zedler (1706-1751) soll er aber auch gegen "verstopfte Leber", Nierensteine und Zahnschmerzen geholfen haben.
Reuters

Heutzutage haben die weiß-grün-violetten (dazu später mehr) Stängel noch immer auch abseits der Küche einen guten Ruf. Wissenschaftliche Studien schreiben ihm nach wie vor diverse gesunde Eigenschaften - vor allem für die Nieren, die Milchproduktion bei stillenden Müttern und bei der Behandlung eines Katers - zu.
Reuters

In Österreich ist der Spargel ab Mitte des 16. Jahrhunderts nachweisbar, damals galt er als Diätmahlzeit Erzherzog Ferdinands. Fürstlich war schon damals der Preis für das Gemüse, der seinem geringen Nährwert in einigem nachstand. Für die arbeitende Bevölkerung war Spargel deshalb kein Thema.
Reuters

Und wie bestellte Kaiser Franz II. seinen Spargel? Zu den beliebtesten Hofgerichten zählten: grüner Spargel mit Parmesan, gefüllter Kopfsalat mit Spargelspitzen und Spargelspitzen mit in Ei-Obers getauchten und gebackenen Weißbrotscheiben.
Imago

Nachdem Wien im 17. Jahrhundert endgültig zum Hauptwohnsitz, zur Residenzstadt der Habsburger wurde, musste auch der Spargel in der Nähe des Adels wachsen. Die Kühlkette reichte damals nur bis in die nähere Umgebung, weshalb sich Korneuburg, Stockerau und das Marchfeld als Anbauzentren entwickelten.
Imago

Spargel ist eine einkeimblättrige Staude, die traditionell zur sehr umfangreichen Familie der Liliengewächse gehörte, mittlerweile zählt man ihn zu den Spargelgewächsen. Die Gattung Aspáragus umfasst etwa 300 Arten, von denen über 100 in den an das Mittelmeer grenzenden Ländern und die übrigen in Asien verbreitet sind.
Imago

Für eine erfolgreiche Spargelkultur ist lockerer, humusreicher, sandiger Boden notwendig, wobei wärmere Klimabereiche höhere (und frühere) Erträge bringen. Zur Pflanzung müssen Gräben im Abstand von rund zwei Metern gezogen werden. Die Pflanzen werden heute meist maschinell in 15 - 20 cm Tiefe gedrückt und mit Erde bedeckt.
(c) REUTERS

In den ersten beiden Jahren kann man sich den Auflauf aufzeichnen, da bringt die Spargelkultur keinen Ertrag. Die Erntezeit beträgt anfangs vier bis sechs Wochen, später rund acht Wochen.
Imago

Prinzipiell lässt sich Spargel in Grün und Weiss ziehen. Ausschlaggebend ist der Anbau. Wachsen sie oberhalb der Erde werden sie durch das Chlorophyll grün. Häuft man sie mit Erde an, bleiben die Sprossen weiß. Eine neue Züchtung ist der Purpurspargel. Violett und Grün sind im Geschmack intensiver.
Imago

Frisch gestochener Spargel hat fest geschlossene Spitzen und eine saftige, helle Schnittfläche. Er quietscht, wenn man die Stangen aneinander reibt, und lässt sich leicht brechen. Eine gelbliche Farbe weist daraufhin, dass er schon vor längerer Zeit gestochen wurde.
Reuters

Frischer weißer Spargel kann – in ein feuchtes Tuch eingewickelt – gut zwei bis drei Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden. Grünen Spargel lagert man am besten aufrecht im Wasser stehend.
Imago

Neben dem sanfteren Geschmack hat der weiße Spargel noch einen Nachteil. Man muss ihn schälen, eine Arbeit, die beim grünen Kollegen wegfällt. Dazu setzt man den Spargelschäler etwa zwei Zentimeter unterhalb des Köpfchens an und schält von oben nach unten. Die holzigen Enden sollte man entfernen.
Imago

Man kocht den Spargel am besten bündelweise in einem speziellen Siebeinsatz, sodass die zarten Spitzen außerhalb des Wassers durch den Wasserdampf gegart werden. Nach ca. 10-15 Minuten ist das Gemüse gar. Eine Prise Salz und Zucker, sowie ein Stich Butter erhöhen das Aroma.
Imago

Spargel besteht zu 95 Prozent aus Wasser und hat nur 15 Kalorien pro 100 Gramm - allerdings spielt die Art der Zubereitung eine wesentliche Rolle. Spargel ist außerdem reich an Vitamin A, B und C, besonders viele Vitalstoffe befinden sich in seinen Spitzen.
Imago

Schon bei den alten Römern galt Spargel als Aphrodisiakum. Im Frankreich des 19. Jahrhunderts gab es die Tradition, dass ein Bräutigam große Mengen Spargel verzehrte, um für die Hochzeitsnacht gewappnet zu sein. Sein lustbringendes Image verdankt der Spargel aber eher seiner phallischen Form. Konkrete Hinweise für einen sexy Inhalt gibt es keine.
Imago
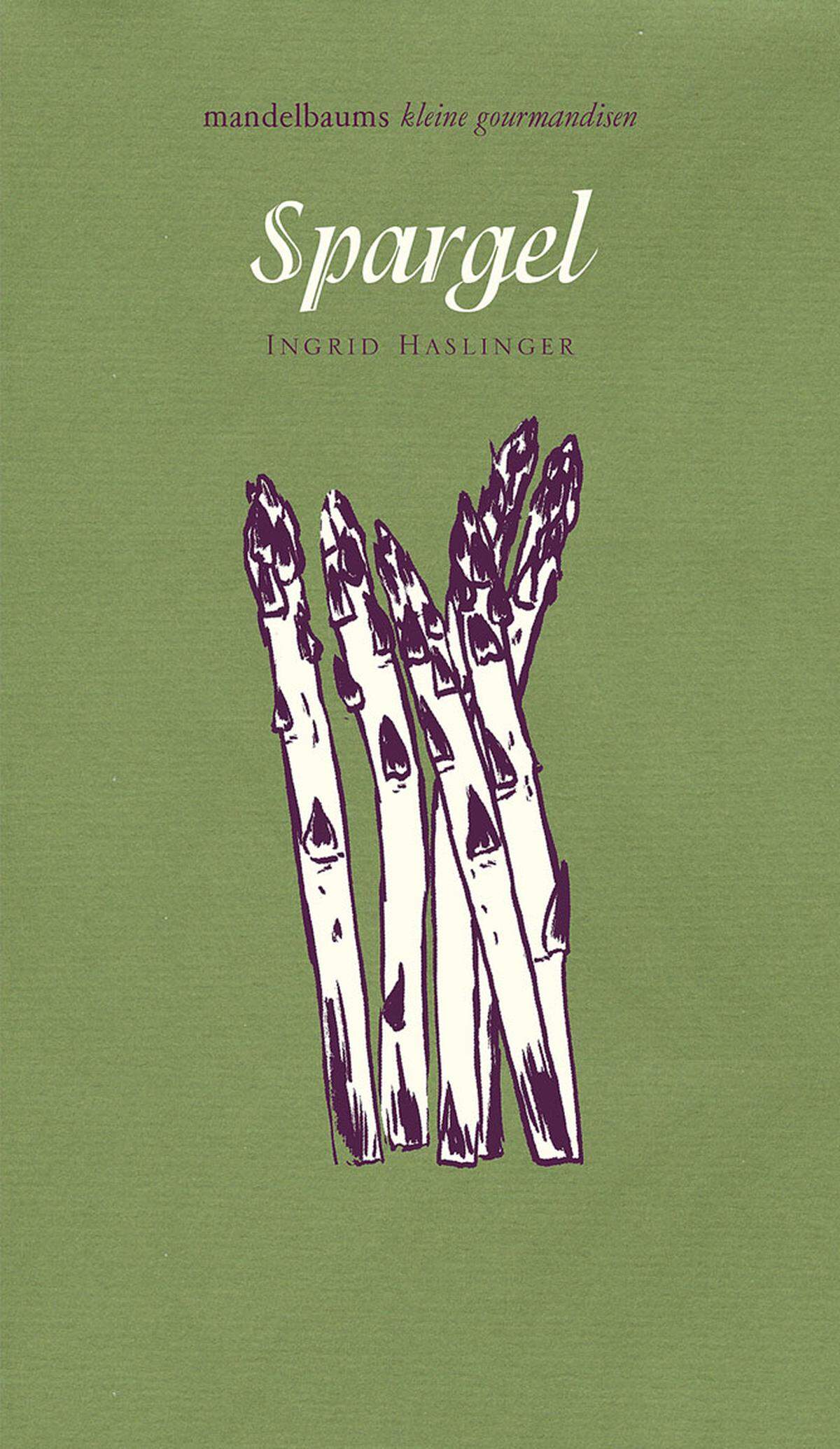
Auch in dieser Saison sind wieder neue Spargelwerke erschienen. Zwei greifen wir heraus. Ingrid Haslingers liebevoll gestaltetes "Spargel"-Buch ist im März im Mandlbaum Verlag erschienen. Neben geschichtlichen Hintergründen bringt es auch eine kleine Rezeptsammlung mit.
Mandlbaum Verlag
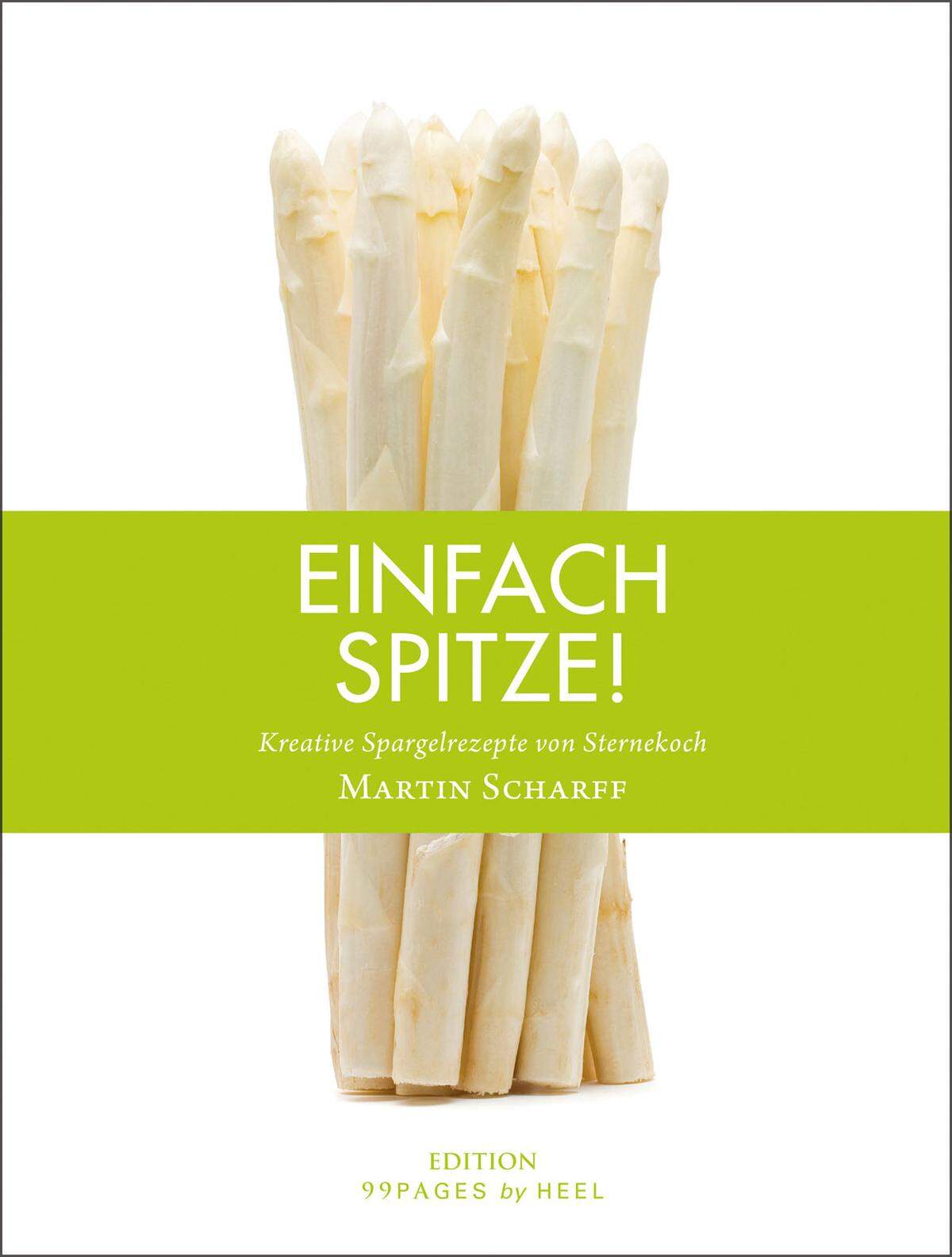
Diese neue Rezeptsammlung von Martin Scharff, Sternekoch und Chef der Heidelberger Schlossgastronomie, verspricht modern und voller Überraschungen zu sein. "Einfach Spitze" ist im Heel Verlag erschienen.
Heel Verlag
