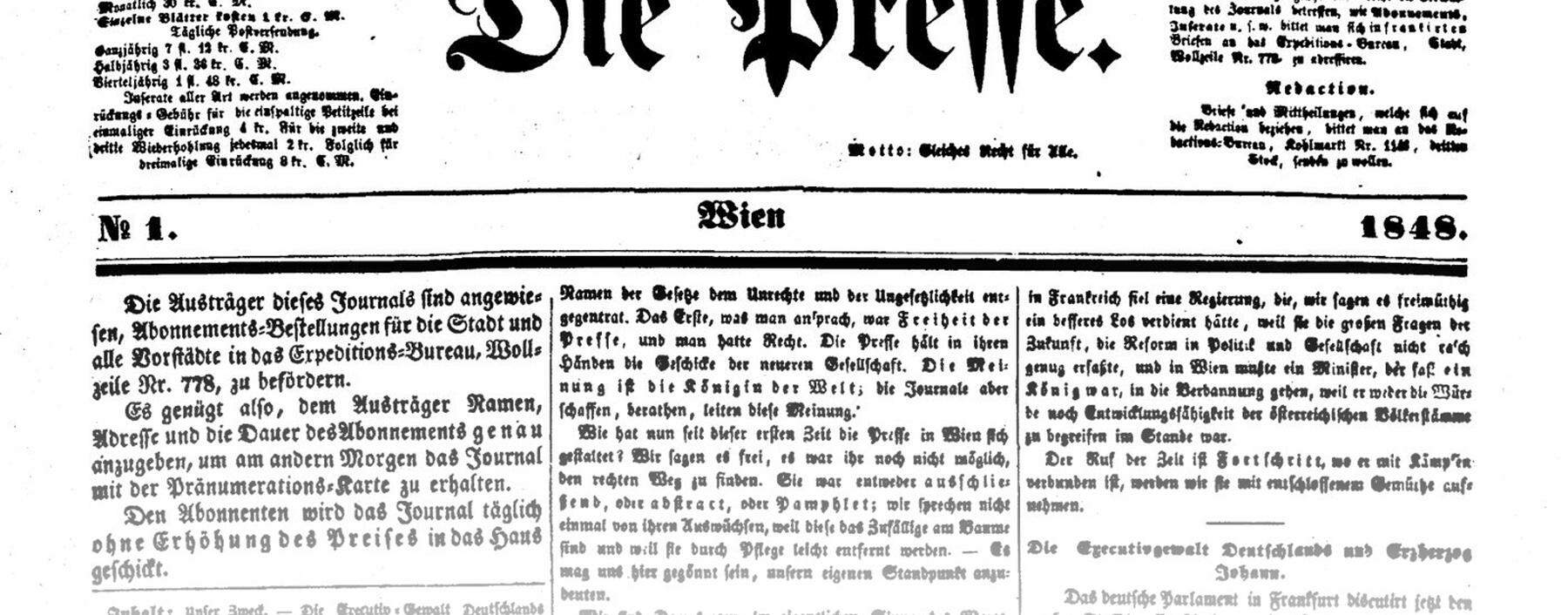Ein hoher Offizier der alten Armee teilt mit der „Neuen Freien Presse“ seine Informationen.
Neue Freie Presse am 17. Juni 1934
Das Abrüstungsproblem hat bisher trotz aller Anstrengungen keine Fortschritte zu verzeichnen; nicht einmal in der Frage des Luftkrieges, der die Zivilbevölkerung aller Staaten bedroht und die Grausamkeit weit zurückliegender Kriegszeiten übertrumpfen würde, ist man zu bindenden Abmachungen gelangt. Alle Staaten bereiten den Luft- und chemischen Krieg intensiv vor, und es kann kaum ein Zweifel sein, daß er in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
Da im Weltkrieg eine Waffenentscheidung nicht erzielt wurde und die Entente ihren Enderfolg der überlegenen wirtschaftlichen, materiellen und geistigen Kriegsführung (Propaganda) verdankte, ist man leicht geneigt, in der Zermürbung des feindlichen Volkes ei taugliches Mittel zum raschen Erreichen des Kriegszweckes zu sehen. Also krieg gegen die Heimat des Feindes! – um die für den modernen Materialkrieg unentbehrlichen Kraftquellen des Gegners zu vernichten, m Lande panischen Schrecken zu verbreiten und schließlich den Kriegswillen des Volkes und seiner Regierung zu brechen.
(…) Der wesentlichste Unterschied gegenüber dem Weltkrieg besteht darin, daß die Luftmacht nunmehr ebenbürtig neben die Land- und Seemacht tritt, und innerhalb der an die Erde gebundenen Streitkräfte der Tankwaffe eine bedeutsame Rolle zufällt. Im Weltkrieg hatten die verschiedenen Fliegerstaffeln noch mehr den Charakter einer Hilfswaffe, der die Unterstützung der Infanterie und Artillerie im Gefecht, die Aufklärung und die Bekämpfung feindlicher Flugzeuge oblag.
Die gegenwärtig in einzelnen Staaten organisierten Luftformationen mit ihren leistungsfähigen Tag- und Nachtbombern und zahlreichen Jagdflugzeugen sind für jene Aufgaben vorgesehen, die man seinerzeit den großen Kavalleriekörpern, wie zum Beispiel den russischen Reitermassen für einen Einfall in die Grenzgebiete zudachte. Nur ist ihre Bewaffnung, Schnelligkeit und Aktionsweite ungemein stärker. Diese großen Luftstreitkräfte wären auch geeignet, durch einen überraschenden Stoß gegen das Herz des feindlichen Landes, gegen seine industriellen, politischen und militärischen Machtzentren den Kriegswillen der Bevölkerung zu schwächen oder gar zu brechen, vielleicht noch bevor es zur entscheidenden Erdschlacht gekommen ist.
„Presse“-Leser führen „Beschwerdebuch“
Eine neue Rubrik für alle gibt es in der Zeitung – wo man sich ärgern und aufmerksam machen kann. Ein Leser nützt es für Kritik an „Urlaub und Monatskarten“!
Neue Freie Presse am 16. Juni 1934
Der Leser Poldi Fiala schreibt uns: „Man nimmt jetzt überall auf „Urlauber“ Rücksicht, aber die Straßenbahn kümmert sich nicht um Inhaber von Monatskarten, die beruflich einige Male im Tage die Straßenbahn benützen müssen und zum Beispiel in der Mitte des Monats ihren Urlaub antreten sollen. Die Streckenkarte kostet 18 Schilling. Soll man dies viele Geld für einen halben Monat bezahlen?
Und das muß man doch, wenn man vom 15. An nicht mehr in Wien ist. Oder aber man muß vom Monatsbeginn bis zum Urlaubsantritt den regulären Fahrpreis bezahlen, unter Umständen vier Fahrten zu 35 Groschen im Tag – beide Fälle bedeuten eine arge Schädigung des armen Monatskarteninhabers. Warum läßt es sich nicht machen, daß man in den Urlaubsmonaten – also von Mai bis September – halbmonatliche Abonnementkarten bekommen kann? Oder, wenn dies nicht geht, wenigstes das Recht erhält, gegen Abmeldung die bezahlte Zeit nach der Rückkehr „gut“ zu haben?“
Es wimmelt heute nur so von falschen Anklagen
Das Kino mit sich selbst hat in Österreich gerade Hochkonjunktur.
Neue Freie Presse am 15. Juni 1924
Der ehemalige Bezirkshauptmann und Nationalratskandidat hat geflunkert. Er hat keine hundertfünfundsiebzig Millionen im Besitz gehabt, und sie konnten ihn daher folgerichtig auch nicht entrissen werden. Die ganze Geschichte von dem Raubanfall nächst dem Stadtpark ist aus der Luft gegriffen. Aus der Luft der aufgeregten, von Nervosität zitternden und vibrierenden Gegenwart, in der wir alle leben.
Der Verbrecherfilm, den Herr Otto Dahinen ersonnen hat, dessen nicht gerade dankbare Hauptrolle er sich selbst auf den Leib schrieb und die er mit wahrer Selbstverleugnung spielte, ist abgerollt, ohne daß der erträumte Erfolg sich eingestellt hätte. Was wäre aber bestenfalls dieser Erfolg gewesen? Der Bezirkshauptmann war seine Hotelzeche schuldig geblieben, hatte auch sonst mit allerlei finanziellen Schwulitäten zu kämpfen, und um bei seinen Gläubigern nicht in Mißkredit zu geraten, wollte er sich den Anschein geben, als habe er über die Mittel verfügt, sie zu befriedigen, wenn eben nicht das an ihm verübte Raubattentat dazwischengekommen wäre.
Die Gläubiger hätten freilich davon, genau genommen, blutwenig gehabt. Ihre Forderungen waren aufrecht und unbezahlt geblieben wie zuvor. Nur hätten sie dem säumigen Schuldner den Respekt nicht verweigern dürfen. Er hätte hocherhobenen Hauptes vor sie hintreten dürfen, jeder Zoll ein Edelmann. Welcher Gehrock wäre auch unbarmherzig genug gewesen, das Pfund Fleisch aus seinem mageren, mißhandelten Leib zu schneiden? Der Bedauernswerte, den der Faustschlag des Räubers vor einem Haustor in der Hegelgasse niedergeschmettert hatte. Ob sich der phantasievolle Bezirkshauptmann mit gutem Vorbedacht just die Hegelgasse ausgesucht hat? Er hätte vielleicht besser daran getan, an den Namenspatron dieser Gasse zu denken, der bekanntlich gelehrt hat: das Gute und das Vernünftige ist stets wirklich, und alles, was wirklich ist, ist vernünftig, indem es ewig als Zweck sich setzt und als Tätigkeit oder Prozeß sich ewig selbst hervorbringt.
Aber das Raubattentat, von dem Herr Dahmen phantasierte, war eben nicht wirklich, und der Prozeß, den sein Märchen nach sich ziehen wird, dürfte sich um eine Irreführung der Behörde drehen. Die Behörde hat sich allerdings nicht allzulange irreführen lassen. Sie ist gewitzigt. Sie wird durch tägliche Erfahrung darüber belehrt, da das Kino mit sich selbst heutzutage in allen Ständen und sozialen Schichten gleich beliebt ist. Es wimmelt von falschen Anklagen.
Der Schilling kommt
Wir erklimmen wieder die Rangstufe eines währungspolitischen zivilisierten Volkes.
Neue Freie Presse am 14. Juni 1924
Gestern war er noch eine Primeur. Er hatte Seltenheitswert und wurde mit einem Aufgeld gehandelt. Der neue Schilling nämlich, dessen offizieller Geburtstag auf den Montag der nächsten Woche fällt. Das ist übrigens gut so. Warum soll der Tag, an dem wir wieder die Rangstufe eines währungspolitisch zivilisierten Volkes erklimmen, just ein Freitag und ein Dreizehnter dazu sein, damit die alten Weiber und sonstige Abergläubische bedenklich den Kopf schütteln.
Der Schilling hat manche gewiß gerechtfertigte Kritik von vornherein erfahren. Man hat gegen Nam‘ und Art Einwände erhoben. Aber selbstverständlich werden wir uns durch diesen und durch andere Schönheitsfehler unseres neuen Hartgeldes nicht das beglückende Bewußtsein rauben lassen, daß wir einen ganz gewaltigen Schritt nach vorwärts zu machen im Begriffe sind. Heraus aus der Fetzenwirtschaft, in der das Papier seine sprichwörtliche Tugend der Geduld einbüßte und solide Grundsätze und solide Brieftaschen gleichermaßen ruinierte! Das papierene Zeitalter der Republik Oesterreich ist vorüber und vom nächsten Montag an beginnt, um das berühmte Goethe-Wort anläßlich der Kanonade vom Balmy wieder einmal zu zitieren, eine neue Epoche der Weltgeschichte oder sagen wir einschränkend, wenigstens eine solche der Geschichte Oesterreichs. Rückkehr zum Portemonnaie!
Es bleibt uns unbenommen, mit den Schillingen in der Hosentasche zu klimpern. Der moderne Judas - es soll seinesgleichen auch heutzutage geben - wird wieder über Silberlinge verfügen. Gut Ding braucht bekanntlich Weile, und es wird leider voraussichtlich geraume Zeit dauern, bis wir wieder den großen Nullenrausch der Inflationszeit ausgeschlafen haben werden, bis wir uns gewöhnt haben, in Schillingen, in Stübern und Doppelstübern zu rechnen. Auch wird man jenen Ehrenmännern auf die Finger schauen müssen, die vielleicht auf die gute Idee kommen dürften, diese Metamorphose, die aus den zerschlissenen, in der Mitte mit einem Papierstreifen mühselig genug zusammengeklebten Zehntausendern ein schmuckes, blinkendes Silberstück werden läßt, zu einem kleinen Hinaufnumerieren auszunützen. Zunächst aber hängt der Währungshimmel voller Geigen und mit einiger Phantasie kann man sich sogar einbilden, die gute, alte Vorkriegszeit sei wieder da, wo man sich darüber beklagte, daß das Hartgeld die Hosensäcke bedrohe, wo man Goldstücke überhaupt nicht entgegennahm, weil doch die Gefahr bestand, sie mit einem neugeprägten goldglänzenden Zweihellerstück zu vertauschen. Solche Irrtümer sind freilich gegenwärtig ausgeschlossen.
Der Silberschilling hat einen ganz netten Umfang. Er ist nur um ein Geringes kleiner als das selige Zweikronenstück, das vielleicht in verschwiegenen alten Strümpfen ein märchenhaftes Kaiser Rotbart-Dasein führt, ungeweckt vom Finanzminister und vom Steuerkommissär. Auf der Kopfleiste das Parlamentsgebäude mit Nachsicht des Minerva-Brunnens, was gewiß nicht eine Zustimmung für Axel Oxenstjerna bedeutet, der gemeint hat, die Völker wüßten nicht, mit wie wenig Weisheit sie regiert würden. Auf der Reversseite das Staatswappen, umgeben von wohlverdienten Oelzweigen, und die Umschrift: Ein Schilling. Revolution in der Hosentasche, aber eine Revolution, die Anhängern aller politischen Parteien von der äußersten Linken bis zur äußersten Rechten hochwillkommen ist. Eine Epoche ist hoffentlich für immer abgeschlossen, in der man nur allzuoft daran erinnert wurde, daß einerseits Papier aus Lumpen gemacht wird und andererseits Lumpen es am besten verstehen, sich möglichst viel Papiergeld zu machen.
Das neueste Geschäft von Harry Sinclair
Im Alter von 25 Jahren ging er als Besitzer eines Drogengeschäftes in Konkurs. Nun ist er Petroleummagnat – und bekommt eine Krone angeboten.
Neue Freie Presse am 13. Juni 1924
Wie der „Chicago Tribune“ aus Bukarest berichtet wird, hat eine Versammlung der dortigen albanesischen Kolonie beschlossen, dem amerikanischen Petroleummagnaten Harry F. Sinclair die albanesische Königskrone anzubieten. Diese Kandidatur erhielt in der Versammlung hundert Stimmen. Eine Stimme fiel auf den Prinzen Sixtus von Parma. Die albanesische Kolonie in Bukarest hat den Beschluß der Versammlung Sinclair übermittelt und ihn aufgefordert, sich offiziell um die albanesische Königskrone zu bewerben.
Sinclair, der in den amerikanischen Korruptionsaffären vielfach genannt wurde, ist ein ungemein tüchtiger Herr. Schon im Alter von 25 Jahren ging er als Besitzer eines Drogengeschäftes in Konkurs. Dann verlegte er sich auf das Petroleumgeschäft und spekulierte so glücklich, daß er bald zu bohren beginnen konnte und so große Summen verdiente, um selbst dem Oelfrust gewachsen zu sein.
Seine Pläne stiegen dann ins Gigantische und er sicherte sich Petroleumvorkommen auch außerhalb Amerikas, so in Afrika, in Rußland und in Persien, kurz, man konnte von ihm sagen: jeder Zoll ein Petroleumkönig. Daß man ihm aber einmal die Königskrone von Albanien antragen werde, das hat Harry Sinclair wohl in seinen- kühnsten Träumen nicht gedacht.
Anmerkung: Harry Ford Sinclair (6. Juli 1876 - 10. November 1956) war ein amerikanischer Industrieller und der Gründer von Sinclair Oil. Er war in den Teapot-Dome-Skandal der 1920er Jahre verwickelt und saß wegen Missachtung des Kongresses sechs Monate im Gefängnis. Obwohl dies seinem Ruf schadete, kehrte er in sein altes Leben zurück und genoss dessen Wohlstand bis zu seinem Tod.
300 Opfer in 15 Tagen
Der Aufstand in Albanien scheint – per Basisdemokratie – beendet.
Neue Freie Presse am 12. Juni 1924
„Corriere Italiano“ meldet, daß Achmed Zogu, als das Feuer der Maschinengewehre in Tirana hörbar wurde, in der Stadt habe Sturm läuten lassen, und als sich seine Getreuen um ihn versammelt hatten, sie gefragt habe, ob sie die Uebergabe oder die Fortsetzung des Widerstandes wünschen. Die große Mehrzahl war für die sofortige Uebergabe. Darauf befreite Zogu seine Anhänger von ihrem Schwur und eine allgemeine Flucht begann.
Zogu selbst verließ in der Nacht in Begleitung von etwa zwanzig seiner Getreuen, in einen Mantel gehüllt, die Flinte umgehängt, mit einem Köfferchen, die Stadt. Man nimmt an, daß er sich nach Jugoslawien geflüchtet habe, wo er – wie der „Corriere Italiano“ bemerkt – sicherlich gut aufgehoben sein wird.
Die aufständische Bewegung in Albanien hat somit fünfzehn Tage gedauert und nach den Schätzungen etwa dreihundert Opfer gefordert. Die Nationalisten haben beschlossen, die Kosten des Aufstandes durch Konfiszierung des Eigentums reicher Albanesen zu decken und den Grund und Boden der geflüchteten Bens unter das Volk zu verteilen.
Anmerkung: Am 23. Februar 1923 wurde Ahmet Zogu im Parlament angeschossen. Im Frühjahr 1924 kam es zu einem Aufstand der Opposition und Zogu flüchtete aus dem Land ins benachbarte Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Im Dezember 1924 war Zogu aber bereits wieder zurück in Tirana, hatte eine Armee zusammengestellt. Von 1925 bis 1928 füllte er das Amt des Präsidenten Albaniens aus, von 1928 bis 1939 regierte er als Zogu I., König der Albaner.
Die Mörder des amerikanischen Millionärssohnes
Eine Konfrontation der besonderen Art.
Neue Freie Presse am 11. Juni 1924
Wie aus Chicago nach London gemeldet wird, wurden die beiden Studenten Natan Leopold und Richard Loeb, die der Entführung und Ermordung des 14jährigen Sohnes des amerikanischen Uhrmacherkönigs Jakob Frank angeklagt sind, durch die Polizei dem Chauffeur Ream gegenübergestellt, der vor einigen Monaten in einer der Straßen Chicagos von Unbekannten angefallen worden war.
Den Revolver in der Faust, hatten diese ihn in ein Auto zu steigen gezwungen, wo der Unglückliche, nachdem er chloroformiert worden war, durch seine Angreifer in grausamer Weise verstümmelt wurden.
Die Konfrontation gestaltete sich dramatisch. Der Chauffeur hatte die beiden Millionärssöhne, das sind nämlich auch die beiden Täter, kaum bemerkt, als er erbleichte und nach dem erschrockenen Ruf: „Das sind Sie!“ das Bewußtsein verlor. Als er wieder zu sich kam, erklärte Ream, nicht mit Sicherheit behaupten zu können, daß die Studenten die Täter gewesen seien, daß aber jedenfalls eine frappante Aehnlichkeit in den Gesichtszügen und in der allgemeinen Haltung der beiden mit seinen Angreifern vorhanden sei.
Wenn 300 Frontkämpfer nach Graz aufbrechen
Das Pfingstwochenende ermunterte die Wiener Männer zu einem Ausflug.
Neue Freie Presse am 10. Juni 1924
Samstag abend versammelten sich auf dem Südbahnhofe 300 Mitglieder der Wiener Frontkämpfervereinigung mit Musik. Sie fuhren nach Graz, wo Sonntag ein Wiedersehensfest und eine kameradschaftliche Zusammenkunft der Angehörigen des „Eisernen Korps“ stattfand.
Die Rückkehr erfolgte Pfingstmontag früh. Der Frontkämpferzug marschierte geschlossen vom Südbahnhof über den Gürtel durch die Favoritenstraße nach der Stadt. Beim Wiedner Krankenhause wurde haltgemacht und eine Abordnung der Frontkämpfer trat ins Spital ein und überbrachte für den Bundeskanzler Dr. Seipel einen Blumenstrauß. Die Herren trugen auch ihre Namen in den für den Kanzler aufliegenden Besuchsbogen ein, Nach dieser Kundgebung ging der Zug bis zum Schwarzenbergplatz, wo die Auflösung in bezirksgruppen erfolgte.
Heute vor 90 Jahren: Eine Fahrt nach Palästina
Auf dem schwimmenden Hotel sind drei Klassen – eine davon ist besonders erregt.
Neue Freie Presse am 9. Juni 1934
Uebervolles Schiff, da das gelobte Land als rechtlich gesicherte Heimstätte jetzt besondere Anziehung ausübt. In der ersten und zweiten Klasse fahren die, die als Kundschafter ausgesandt sind, wie es in der Bibel steht, „das Land Kanaan zu erkunden, aus jeglichem Stamm ein vornehmer Mann“. Mit anderen Worten solche, die sich’s leisten können, erst einmal Umschau zu halten, vor dem endgültigen Entschluß. Die dritte Klasse füllen die, denen keine andere Wahl bleibt, die hin müssen, ohne Probebesichtigung.
Aus den vornehmen Leuten der oberen Klassen spricht ruhige Gelassenheit, in der dritten Klasse tobt Erregung, Gier, das Neue zu sehen, Neugier auf das unbekannte Land. Darum ist es weise von der Schiffsgesellschaft, daß in der dritten Klasse ein Hüter eingesetzt ist mit Amtsgewalt, der die Wünsche der Aufgeregten hört, der hierhin, dorthin beschwichtigt.
Schon vom Ausgangshafen Triest an hat der Hüter mit der Dienstkappe viel Arbeit, die Schäflein zu hüten, die unruhig durcheinanderlaufen in Angst und Neugier. Viele von ihnen sind dem alten Gesetz treu, das während der Ueberfahrt rücksichtsvoll respektiert wird – der Hüter ist nicht nur über die Passagiere gesetzt, sondern auch oberste Aussicht in der Küche, daß sie sich streng an den Ritus halte. Nicht überall wird hierin so zarte Rücksicht geübt.
Aufgeregte und Gelassene, Rituelle und Freigeister, Endgültige und Kundschafter… alle bringt das schwimmende Hotel in weniger als fünf Tagen ins Gelobte Land, an dessen Pforte der englische Sergeant steht und kategorienweise prüft, ob jeder, der Einlaß verlangt, das bei sich führt, was sein Visum verlangt: die tausend Pfund, die ihn zum Kapitalisten, die ihn zum Kapitalisten stempeln, oder wenigstens die fünfzig für die Notdurft der ersten Zeit, bis Arbeit gefunden ist.
Darum, daß jeder Arbeit findet, ist keine Not; denn das im Aufbau befindliche Land verlangt Hände. Palästina braucht Arbeiter, es kennt keine Arbeitslosigkeit, also ist es für den, der aus dem Westen kommt, auch in einem anderen Sinne das Gelobte Land.
Der Ehekoffer
Gerade wenn eine Frau recht hat, soll man das nicht so rasch zugeben.
Neue Freie Presse am 8. Juni 1924
Ein Ehemann schreibt uns: Seit gestern ist meine Frau restlos glücklich, denn einer ihrer siebzehn einzigen Lieblingswünsche ist endlich in Erfüllung gegangen. Nicht etwa in Gestalt einer Perlenbajadere, einer brillantbesetzen Ringuhr, daraus macht sich meine praktische Gattin Gott sei Dank ebensowenig wie ich aus der Anschaffung dieser Dinge. Sie trägt auch kein Verlangen danach, nach Trouville oder Biarriß zu gehen, sie begnügt sich, bescheiden, wie sie ist, mit einer Pfingstfahrt an den Lido und würde sogar mit dem Semmering vorlieb nehmen, Ihr ist jedes Reiseziel recht, wenn wir es nur in Gesellschaft eines Dritten aufsuchen, und zwar eines Schrankkoffers zum Hängen und Legen.
In dem Zwanzigstel Jahrhundert, das wir nun verheiratet sind, ist bei Eintritt der schönen Jahreszeit ihr drittes Wort: „Kaufen wir uns doch einen Schrankkoffer. Daß du nicht einsehen willst, wie praktisch und bequem das ist.“ Natürlich hatte ich es schon seit langem eingesehen, denn nichts ist mir unangenehmer, als diese großen, altmodischen Rohrplattenkoffer, in die man alles hineinstopft, aus denen man aber unterwegs ohne Gallenreizung nichts herauskriegt.
Wenn man ein bestimmtes Paar Schuhe braucht, muß man eine halbe Stunde lang in hilfloser Wut Anzügen und Wäsche hindurch sichten, um selbstverständlich zwei nicht zusammengehörende Schuhe zu erwischen. Bei Zollrevisionen muß man ohnmächtig zusehen, wie der Beamte gemütlos in dem Koffer umrührt wie in einer Nudelsuppe.
Wie gesagt, innerlich war ich von den Vorzügen des Schrankkoffers längst überzeugt, aber äußerlich tat ich aus Gründen der Ehepolitik nichts dergleichen. Denn gerade wenn eine Frau recht hat, soll man das nicht so rasch zugeben, sonst wird sie übermütig, und je länger man mit der Erfüllung eines Lieblingswunsches zögert, desto größer ist dann die Freude. Abgesehen davon, daß man die vier, fünf Millionen, die man in einen solchen Schrankkoffer investieren muß, mittlerweile in Form von Kostgeld vorteilhaft anlegen kann.
Immer mehr Frauen an den Universitäten
Im letzten Studienjahr entfiel an Österreichs Universitäten fast ein Viertel der Hörerschaft auf das weibliche Geschlecht.
Neue Freie Presse am 7. Juni 1934
Es hat eine Zeit gegeben, in der ein heftiger Kampf für und gegen die Zulassung des weiblichen Geschlechts zum Universitätsstudium tobte. Seither ist die Frau mit dem Doktordiplom eine selbstverständliche Erscheinung geworden, die man sich aus dem sozialen Leben nicht mehr wegdenken kann. Im letzten Studienjahr entfiel an sämtlichen Universitäten Österreichs zusammengenommen fast ein Viertel der Hörerschaft auf das weibliche Geschlecht. Unter über siebzehntausend Studierenden der philosophischen Fakultät befanden sich vierzig Prozent Frauen.
Dieser Andrang war sicherlich zu nicht geringem Teil dem Wissensdurste zuzuschreiben, dem heißen Wunsche, der Bildungsschicht des Volkes zugezählt zu werden. Nicht weniger stark, ja vielleicht noch entscheidender erwiesen sich aber gewiß sehr ernste wirtschaftliche Erwägungen. Wer heute eine Stellung finden will, der muß mit den schärfsten Formen des Wettbewerbs rechnen und darauf bedacht sein, sich mit allem möglichen Rüstzeug zu versehen.
Das Doktordiplom verschafft - abgesehen von den akademischen Berufen - einen Vorsprung, den sich viele der Studentinnen zu sichern suchen. Kein Zweifel, ein Idealzustand ist es nicht, wenn die Frau gezwungen wird, außerhalb der Familie, außerhalb des eigenen Heimes dem Verdienste nachzugehen, auch wenn sie sich in der Tiefe ihres Wesens zu ihrer eigentlichen Sendung hingezogen fühlt. Doch wer will in der Gegenwart von idealen Zuständen reden und die Wünsche ganz und gar auf sie konzentrieren?
Der Zinsfuß wird erhöht
Die Erhöhung könnte zu einer weiteren Verteuerung der schon jetzt unleidlich gewordenen allgemeinen Geldverhältnisse führen.
Neue Freie Presse am 6. Juni 1924
Die Erhöhung des Zinsfußes der Nationalbank von 9 auf 12 Prozent hat in finanziellen Kreisen lebhafteste Beachtung gefunden. Es wurde anerkannt, daß manche währungspolitischen Gründe für eine Erhöhung des Zinsfußes sprechen, daß auch das Bestreben der Nationalbank anerkannt werden müsse, allmählich die Herrschaft über den Geldmarkt wieder zu erlangen. Anderseits wurde aber mit Recht betont, daß die Zinsfußerhöhung der Nationalbank den Anstoß zu einer weiteren Verteuerung der schon jetzt unleidlich gewordenen allgemeinen Geldverhältnisse bilden könnte.
Wenn die Zinsfußerhöhung der Nationalbank als Vorspann für eine weitere Steigerung der Debetbelastung benützt würde, so müßte gegen eine solche Entwicklung entschiedene Verwahrung eingelegt werden. Bisher hat sich der Diskontsatz der Nationalbank ganz wesentlich unter jenen Vergütungen gehalten, die für Geld verlangt und auch bezahlt worden sind. Wer Geld bei der Nationalbank zu 9 Prozent erhielt, der machte einen Haupttreffer, denn er hatte, falls er es nicht im eigenen Betriebe zu so günstigen Bedingungen verwerten konnte, die Möglichkeit, es zu einem drei- selbst vierfachen Satze auszuleihen, was auch vorgekommen sein soll.
Es ist gar kein Geheimnis, daß selbst in den Kreisen, die maßgebend für die Bestimmung der Einlagenvergütung der großen Banken sind, sich Stimmen geltend machten, die darauf verwiesen, daß man dem Publikum doch für seine Einlagen eine zu niedrige Verzinsung biete. Wenn die führenden Kreditinstitute den Einlagenzinsfuß höher gehalten hätten, so wären sicherlich Kapitalien nicht an Stellen abgewandert, bei denen das höhere Erträgnis oft mit der Gefahr eines Verlustes an Kapital verbunden blieb.
Die Hauptforderung der Wirtschaft ist jetzt darauf gerichtet, daß sich endlich wieder einmal normale Geldverhältnisse entwickeln, und der Druck, unter welchem Handel und Industrie leiden, abgebaut wird. Zur Zeit der Herrschaft einer 9prozentigcn Bankrate hat man an der Börse, und von hier ausstrahlend, zeitweilig 2 und selbst 3 Prozent in der Woche an Zinsen vergüten müssen. Seither haben sich aber die Verhältnisse grundlegend geändert. Der Geldbedarf der Börse ist ein Stück weit bescheidener geworden und wenn auch Schätzungen über die Höhe des Kapitals, welches zu Versorgungszwecken der Börse zur Verfügung gestellt wird, sehr schwer sind, so soll doch eine Ziffer wiedergeben werden, die in finanziellen Kreisen verbreitet wurde. Sie besagte, daß der Bedarf der Börse, soweit die Deckung durch die Banken in Betracht kommt, mit etwa 100 Milliarden zu veranschlagen wäre.
Zu dieser Ziffer sind gewiß manche Kredite inbegriffen, die für andere als rein börsenmäßige Zwecke Verwendung finden. Wenn nun von einzelnen Seiten der Versuch gemacht wird, die Zinsfußerhöhung der Nationalbank sofort auf den freien Geldmarkt auswirken zu lassen, so ergibt sich die Erscheinung, daß am gestrigen Tage Geld noch zu einem Satze von einem Viertelprozent in der Woche erhältlich war, heute aber schon ein halbes Prozent, demnach um 100 Prozent mehr, bei vollkommen gleichbleibendem Bedarfe verlangt wurde. Wenn die Nationalbank bemüht ist, die Herrschaft über den Geldmarkt wieder zu erlangen und den von ihr als angemessen erachteten Satz zur Geltung zu bringen, so wäre es gewiß bedauerlich, wenn das Schlußergebnis darin gipfelte, die Anzeichen einer Entspannung auf dem Geldmarkte, nach welcher die ganze Wirtschaft förmlich lechzt, glatt wieder über den Haufen zu werfen.
Ein Flug nach Budapest
Ein 82-Jährige wagt einen ungewöhnlichen Ausflug – leider ohne Baumwolle in den Ohren.
Neue Freie Presse am 5. Juni 1924
Ein Freund unseres Blattes schreibt uns: „Ich hab’s gewagt. Zwar haben Freunde, denen ich meine Absicht mitteilte, bedenklich das Haupt geschüttelt, indem sie auf meine 82 Jahre hinwiesen. Dennoch vertraute ich mich der Ungarischen Luftverkehrs-Aktiengesellschaft an, von der mir bekannt war, daß sie ausgezeichnete Fahrzeuge holländischer Provenienz und gut erprobte Piloten habe.
Das Ungewohnte des Ausfluges nahm zuerst die Sinne gefangen, aber nicht lange. Schon eine Viertelstunde nach dem Abflug fühlte man sich als Luftmensch, so ruhig war der Gang des Luftschiffes. Man hat das Gefühl, als wäre es durch unsichtbare Bande in der Luft festgehalten, und unwillkürlich kommt einem der Ausspruch des Steinklopferhans in den Sinn: „Es kann dir nichts gescheh‘n.“
Felder öffneten ihre bebauten Flächen grün, gelb, braun wie ein Riesenfächer. Die Häuser der Dörfer und Städte nahmen sich so klein aus, daß man glauben möchte, eine Viehherde zu sehen. Nur die Symmetrie der Bauten sprach dagegen. Mit einem Fernglas hätte man das alles wohl besser gesehen, und ich rate daher künftigen Passagieren, ein solches mitzunehmen Noch ein Rat sei hier eingefügt. Der Propeller arbeitet ziemlich geräuschvoll. Es empfiehlt sich daher, etwas Baumwolle in die Ohren zu stecken.
Das Coupé, welches fünf Personen bequemen Aufenthalt bietet, ist auch groß genug, um Reisegepäck unterzubringen. Einen interessanten Ausblick bot der Neusiedler See, indem man gleichzeitig außer ihm die Donau und den Schneeberg erblickte. Letzterer hatte noch einen weißen Mantel, als wollte er in Erinnerung bringen, welch harten Winter wir alle mitzumachen hatten. Bald zeigte sich Raab und dann Komorn, und nach anderthalb Stunden senkte sich das Fahrzeug und landete in Budapest.
Diese ausnehmend kurze Fahrzeit erzielten wir dadurch, daß wir Rückenwind hatten; die gewöhnliche Fahrzeit beträgt zwei Stunden. Das Lastschiff hält gewöhnlich die Höhe von 900 bis 1000 Meter sein, erhob sich aber einmal bis zu 2000, als die Windrichtung dies gebot. Da ging die Fahrt über den Wolken
Dahin. Durch das halb geöffnete Fenster strömte die Luft etwas kühler herein, sonst aber empfand man keine Veränderung. Zu vermerken wäre noch, daß man nicht wahrnimmt, wie schnell das Luftschiff eigentlich dahinzieht; dem Gefühle nach schleicht es im Tempo der Postkutsche, während es doch 130 Kilometer ins der Stunde zurücklegt.
Amerika leidet unter katastrophaler Dürre
Im ganzen Mittelwesten herrscht Rekordhitze.
Neue Freie Presse am 4. Juni 1934
Die Trockenheit und Dürre in Amerika wächst zu katastrophalen Dimensionen an und wird große politische Konsequenzen nach sich ziehen. Im ganzen Mittelwesten und in Iowa wurden Temperaturen von 108 bis 111 Grad Fahrenheit verzeichnet. Die meteorologischen Stationen erklären, eine derartige Rekordhitze noch nie seit ihrem Bestehen und auch niemals in der Geschichte Amerikas verzeichnet zu haben.
In den letzten drei Tagen wurden einundvierzig Todesfälle infolge der Hitze gezählt. Der Mississippi ist an vielen Stellen tiefer gefallen, als man es je beobachtet hat, während der Sioux vollkommen ausgetrocknet ist. In Kansas erklären die agrarwissenschaftlichen Behörden, daß die Ernte nicht einmal ausreichen werde, um genügend Samen für die nächste Aussaat zu geben. In vielen Staaten verreckt das Vieh zu Tausenden aus Mangel an Weide und Wasser. Man spricht von 50.000 Notschlachtungen.
Der Fürsorgechef der Administration hat in Washington am Samstag provisorisch eine Summe von 5 1/2 Millionen Dollar für zehn von der Dürre heimgesuchte Staaten ausgesetzt. Die Regierung erwägt aber, eine Gesetzesvorlage im Kongreß einzubringen, die 200 Millionen Dollar an Hilfsgeldern bewilligen soll. Im Laufe des heutigen Tages wird der Präsident darüber zu Rate gezogen werden. Gestern spät nachts wurden neuerliche Berechnungen angestellt, um die Summe auf 500 Millionen Dollar zu erhöhen, wobei erklärt wurde, daß es nicht ganz sicher sei, ob dies ausreichen würde.
Schicksal zweier Wiener in Kanada
Ein 20- und ein 22-Jähriger gelangten als blinde Passagiere nach Kanada. Doch das Abenteuer endete tragisch.
Neue Freie Presse am 3. Juni 1924
Zwei junge Wiener, die im Vorfahre nach Kanada ausgewandert sind, haben im Lorenzosrom den Tod gefunden. Der 20jährige Johann Holick und der 22jährige Bäckergehilfe Richard Wagner., die vollständig mittellos waren, beschlossen im Mai vorigen Jahres als blinde Passagiere nach Kanada zu fahren.
Zwei Tage lang hielten sie sich an Bord des Frachtdampfers „Arkansas“ vor der Mannschaft verborgen. Dann kamen sie aus ihrem Versteck und erzählten dem Kapitän ihr Schicksal. Er verwendete sie bei den Arbeiten im Maschinenraum. In Montreal verließen die Wiener das Schiff, wurden jedoch von der Hafenpolizei verhaftet. Als nach acht Tagen die „Arkansas“ nach
Deutschland zurückfahren sollte, wurden die beiden Auswanderer an Bord gebracht, um zurückbefördert zu werden. Sie verschwanden jedoch bald darauf von dem Schiffe und es wurde ermittelt, daß sie sich an einem Tau auf den Wasserspiegel heruntergelassen hatten, um schwimmend die Küste zu erreichen
Die Leiche Holicks wurde bei Quebec ans Land getrieben, die Leiche Wagners ist noch nicht aufgefunden; doch besteht kein Zweifel, daß auch er in dem breiten, reißenden Strom den Tod gefunden hat. Holicks Vater wurde vor Schmerz über den Verlust seines Sohnes vom Schlage getroffen.
Attentat auf den Bundeskanzler
Dr. Seipel wurde durch einen Lungen- und einen Streifschuss schwer verletzt.
Neue Freie Presse am 2. Juni 1924
Schon nahe beim Ausgang stürzte plötzlich von der linken Seite ein Mann vor und im selben Augenblicke feuerte er auch schon aus einer Entfernung von wenigen Schritten rasch hintereinander drei Schüsse gegen den Bundeskanzler ab. Dr. Seipel merkte erst gar nicht, daß er getroffen sei. Er setzte das Gespräch fort und ging festen Schrittes zwischen seinen Begleitern weiter. Erst auf der Treppe hatte er einen Schwächeanfall den er jedoch zu überwinden vermochte. Unmittelbar vor dem Inspektionszimmer, in das man ihn führte, sank er aber in die Knie und mußte nun von den beiden Herren bis zum Sofa getragen werden.
Der Bundeskanzler war die ganze Zeit über bei vollem Bewußtsein, fühlte auch keinen Schmerz und erst auf dem Ruhebette klagte er über einen Druck auf der Brust. Es wurde sofort ärztliche Hilfe herbeigeholt, an der sich auch ein Arzt aus Münchendorf, der gleichzeitig mit Dr. Seipel eingetroffen war, beteiligte. Der Bundeskanzler wünschte, in seine Wohnung gebracht zu werden, da die Aerzte aber eine Spitalsbehandlung für notwendig erachteten, wurde er in das dem Südbahnhofe nahe Wiedner Krankenhaus gebracht.
Anmerkung: Die Stimmung gegen den Obmann der Christlichsozialen Partei, Ignaz Seipel, war 1924 aufgeheizt. Die Reformen, mit denen er den maroden Staatshaushalt sanieren wollte, treiben die Arbeitslosenquote weiter in die Höhe. Auch aus der eigenen Partei gibt es Kritik an dem Prälaten. Der Pottensteiner Spinnereiarbeiter Karl Jaworek gab Seipel persönlich die Schuld an seiner Armut. Am 1. Juni schoss er mit einem Trommelrevolver aus nächster Nähe auf den Kanzler. Danach richtete Jaworek die Waffe gegen sich selbst und traf ebenfalls die Lunge. Er wurde noch auf dem Bahnsteig festgenommen.
Mehr dazu: https://www.diepresse.com/3814040/attentat-auf-kanzler-seipel-ich-glaube-man-hat-auf-mich-geschossen
Es ist gut, dass Gesetze Lücken haben
Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, sollten nicht bestraft werden.
Neue Freie Presse am 1. Juni 1924
Rechtsanwalt Dr. Josef Kläger schreibt uns: Der Durchschnittsmensch, der ja von Haus aus mißtrauisch ist, fühlt sich nur geborgen unter dem Schutze der Gesetze; schon der Anblick der Kappe eines Wachmannes verleiht ihm ein Gefühl der Ruhe und Sicherheit. Gesetz ist ihm gleichbedeutend mit Schutz vor Gefahr. Wer an dem Gesetz rüttelt, ist ein Feind der Gesellschaft, dessen Frivolität nur noch durch den übertroffen wird, der diesen Uebeltäter verteidigt. Darum werden wir Anwälte von all denen mit schelen Augen angesehen, die augenblicklich unserer Hilfe nicht bedürfen. Wir sind und bleiben nun einmal für das große Publikum Gesetzesakrobaten, deren Aufgabe es ist, durch die Lücken des Rechtes hinauszuturnen zum Gipfel des eigenen Vorteils. Diese ungerechte Wertung unseres Standes ist freilich wiederum nur eine Folge menschlichen Mißtrauens, des Mißtrauens gegen unsere Gesetze, deren Fehlerhaftigkeit solche Künste ermöglicht. Und doch ist es gut, daß Gesetze Lücken haben.
Wie furchtbar wäre es, wenn die Gedankenkette des Gesetzgebers hermetisch schließen würde, nicht Raum gäbe für einen Hauch menschlichen Empfindens. Auch Gesetze sind Menschenwerk, fehlerhaftes Stückwerk, und wehe, wenn es keinen Ausweg gäbe, der über die Trümmer veralteter Zwangsmaßnahmen hinausführen würde in die Freiheit modernen vernünftiger und menschlicher Gedankengänge. Wir erleben es heute, wie mit ungeheurer Wucht die große Masse des Volkes sich aufbäumt und sturmläuft gegen die wahnwitzigen Bestimmungen eines veralteten, grausamen Gesetzes, dass Frauen zu Verbrecherinnen stempelt, die aus Verantwortlichkeitsgefühl, Gewissenhaftigkeit und edelster Mutterliebe dem Glück entsagen, Mütter zu werden.
Das Gesetz bestraft als Verbrechen jede Handlung, die unternommen wird, um die Leibesfrucht zu töten oder bewirkt, daß das Kind tot zur Welt kommt. Mit anderen Worten, das Gesetz statuiert für die Frau einen Gebärzwang. Dieser Zwang ist offenbar unvereinbar mit dem Wesen der persönlichen Freiheit. Eine Beschränkung der Verfügungsfreiheit über den eigenen Körper beim Manne kannte nur das Wehrgesetz. Wer zum Militär tauglich war und seine Hand verstümmelte, um sich seiner Dienstpflicht zu entziehen, wurde straffällig. Nur der Krüppel konnte tun, was ihm beliebte. Aus ihm wäre ja doch kein Soldat geworden.
In dieser Brutalität lag Methode und Offenheit. Warum läßt der Staat dieses Prinzip nicht auch beim Weibe gelten? Selbst wenn er ein Recht darauf hätte, Frauen zu zwingen, Kinder zu gebären, dürfte er vernünftigerweise von die ein Rechte nur bei jenen Frauen Gebrauch machen, deren Kinder für ihn einen Gewinn bedeuten. Aus Kindern, in Not, Krankheit und Verzweiflung geboren, aus Kindern, die für ihre Eltern und Geschwister eine last bedeuten, erwächst dem Staate nie und nimmer ein Gewinn. Das werden dann jene Bedauernswerten, die unsere Spitäler, Irrenhäuser und Kerker füllen. (…)
Unser Gesetz bestraft die Abtreibung, das ist die tatsichtliche Tötung der Leibesfrucht und das Bewirken einer Fehlgeburt- Töten kann man nur etwas, was lebt. Die Absicht allein ist nicht strafbar. Wer auf einen Leichnam schießt, begeht niemals einen Mord, auch keinen Mordversuch. Die Voraussetzung für eine Verurteilung für eine Abtreibung wird also nur dann gegeben fein, wenn der Staatsanwalt den Nachweis dafür erbringt, daß die Frucht im Zeitpunkt des Eingriffes wirklich gelebt hat. Jeder Arzt wird bestätigen müssen, daß das Leben der Frucht erst in einem verhältnismäßig sehr späten Zeitpunkt der Schwangerschaft konstatiert werden kann. (…)
Ist es nämlich plausibel, daß das Gut, welches der Täter verteidigt, mindestens ebenso schützenswert ist wie das, das er verletzt, bleibt er straflos. Hält man die Existenz einer Mutter und einiger lebender Kinder für ebenso schützenswert wie die Existenz einer noch ungebornen Leibesfrucht, dann kann in der notwendigen Rettungshandlung ein strafbarer Tatbestand nicht erblickt werden.
Die Forderung einer Schwangerschaftsunterbrechung aus sozialen und wirtschaftlich Gründen zuzulassen, wäre bei dieser Auslegung des Gesetzes ebenfalls bereits erfüllt. Das Gesetz verfehlt seinen Zweck, wenn es ein unfähiger oder schlechter Mensch handhabt· Das schlechteste Gesetz wirkt segensreich, von einem guten, einsichtigen Menschen interpretiert. Auch mit unserem Gesetz kann man zur Not sein Auslangen finden. Eine Voraussetzung ist erforderlich: ein guter, ein einsichtsvoller Richter.
Der Prinz und die Dollarmillionärin
New York hat Grund zu feiern.
Neue Freie Presse am 31. Mai 1924
Newyork steht ein gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges bevor: die am 10. Juni sattfindende Vermählung von Miß Eleonor Margerit Green mit dem Prinzen Viggo von Dänemark. Infolge des erst vor sechs Wochen erfolgten Ablebens des Brautvaters wird die Trauung unter Zuziehung nur des intimsten Freundeskreises stattfinden. Nichtsdestoweniger macht ganz Newyokk krampfhafte Anstrengungen, um wenigstens von der Ferne sie sehen zu können.
Prinz Viggo, geboren am 25. Oktober 1893, ist der jüngste Sohn und das vorjüngste Kind des Prinzen Waldemar von Dänemark, eines Onkels des gegenwärtigen regierenden Königs Christian X.; Prinz Waldemar ist bekanntlich der Bruder der Königin Alexandra von England, der Witwe Eduards VII., der Kaiserinwitwe Dagmar Marie von Rußland und des 1913 ermordeten Griechenkönigs Georg.
Von seinen fünf Kindern haben nur zwei ebenbürtig geheiratet, darunter die einzige Tochter, die Gemahlin des Prinzen Renatus von Bourbon-Parma. Der älteste Sehn verzichtete auf Erbfolgerecht und Rang und nahm den Titel eines Grafen Rosenborg an, um eine Italienerin heiraten zu können. Ein anderer Sohn, Prinz Erik, hat im Februar in Kanada Miß Lois Gooth geheiratet.
Und nun kommt Prinz Viggo an die Reihe, dessen Braut aber tatsächlich zur Elite der amerikanischen Gesellschaft gehört, was Abstammung, Reichtum und verdientes Ansehen anlangt. Ihr Ahnherr wanderte zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts aus England in Virginia ein; ihr Großvater viele Jahre Präsident der Western Union Telegraph Company, war ein ebenso reicher wie angesehener Mann.
Mütterlicherseits aber ist Miß Green mit einem der populärsten Namen Newvorks verbunden.
Ihre Mutter war eine Tochter von Abram S. Hewitt, eines der besten Bürgermeister, die Newyork je gehabt, aus dessen Ehe mit der einzigen Tochter von Peter Cooper, dem noch heute unvergessenen Philanthropen, der so viel für das Newyorker Volksbildungswesen getan hat.
Heute vor 100 Jahren: Die Straßenbahner sind hart und unerbittlich
Werden bald nur noch Privilegierte an heißen Sommertagen kühle Wienerwaldluft genießen können?
Neue Freie Presse am 30. Mai 1924
Es ist ungemein schwer, diesen Stoßseufzer zu unterdrücken. Wir werden zwar keinen Nachtverkehr auf der Straßenbahn haben: dafür wird uns jedoch wieder einmal eine Erhöhung der Fahrpreise in angenehme Aussicht gestellt. Die Straßenbahner sind hart und unerbittlich.
Sie zeigen dem Straßenbahnreferenten die kalte Schulter und sie haben taube Ohren für die schüchternen Bitten der Bevölkerung. Lebensnotwendigkeiten der Großstadtund des großstädtischen Verkehres? Darum kümmern sie sich keinen Pfifferling. Soweit es auf sie ankommt, darf die Versorgung Wiens seeleruhig weitere Fortschritte machen. Es ist allerdings nicht gerade sozial, geschweige denn sozialdemokratisch gedacht, daß in den heißen Sommermonaten einige Atemzüge Wienerwaldluft das Privilegium derer bilden sollen, die sich ein Automobil leisten können.
Aber wegen solcher Kleinigkeiten läßt sich kein Straßenbahner graue Haare wachsen. Unbeschadet der Parteizugehörigkeit wird mit den sozialdemokratischen Brotgebern im Rathause so rücksichtslos umgesprungen, als gelte es irgendeinem Unternehmer, der direkt aus Hauptmanns „Weber“ herkommt, in besonders drastischer Weise den Herrn zu zeigen. Die Rathausgewaltigen haben endlich andere Farbe bekennen müssen als die rote.
Angesichts des einmütigen Verlangens der Gesamtbevölkerung ohne Unterschied der Parteigesinnung und der Parteizugehörigkeit wurde der schüchterne Versuch gemacht, die Straßenbahnbediensteten davon zu überzeugen, es sei weder göttliches Gebot noch auch ein marxistisches Dogma,daß die letzte Blaue um ¾ 11 Uhr in die Remise rollen müsse. Da kam man aber schön an. Der Hinweis auf das Interesse der Gesamtbevölkerung war vergebens. Sogar das Anerbieten materieller Zugeständnisse hatte ebensowenig Erfolg. Die Antwort war ein glattes Nein.
Die Straßenbahner verweisen auf die Unannehmlichkeiten, auf die Beschwerlichkeiten, die ihr Dienst in den überfüllten Straßenbahnwägen mit sich bringe. Vermeiden wir die Untersuchung, ob es nicht am Ende noch andere Arbeitsstätten gibt, die an die Nervenkraft, an die Widerstandsfähigkeit, an die Arbeitsfreude der dort Beschäftigten dieselben, vielleicht sogar größere Anforderungen stellen. Nur die bescheidene Frage sei gestattet, was dann das Publikum sagen soll, das den Aufenthalt in überfüllten Waggons teuer bezahlen muß.
So starben Bonnie und Clyde
“Bonnie” Parker war kaltblütig, grausam und populär.
Neue Freie Presse am 29. Mai 1934
Wie wir bereits meldeten, eröffnete die Polizei von Dallas (Texas) am 23. Mai das Feuer auf Clyde Barrow und seine Freundin “Bonnie” Parker, als die beiden ihr Auto bestiegen. Wenige Augenblicke später fuhr der Wagen in einen Graben und die Polizei fand auf den Vordersitzen die von Kugeln durchsiebten Leichen der beiden langgesuchten Verbrecher.
Barrow hielt noch die Pistolen in der Hand und “Bonnie” einen Maschinenrevolver. Sie war die Leiterin der Unternehmungen und durch ihre dicken Zigarren, die sie in Ketten rauchte, und durch ihre Vorliebe für Kornwhisky sehr populär. Man fand in dem “Nachlaß” ein von ihr von Hand geschriebenes Gedicht “Die Selbstmörderin”, das ihren Stolz auf die begangenen Verbrechen unterstrich und verkündete, “mich werden sie lebenslang nicht bekommen”.
Barrow und Parker ließen sich eine Limousine panzern und mit drei großen Maschinenrevolvern und drei gewöhnlichen Pistolen ausstatten, auch war Platz für eine große Menge Munition. Sie ermordeten einen Polizisten in Miami und entführten den dortigen Polizeichef mit unerhörter Kühnheit. Ferner töteten sie zwei Gendarmen und raubten Dutzende von Lokalen und Personen aus. Es ist eine oft bezeugte Tatsache, daß “Bonnie” sich durch eine besondere Kaltblütigkeit, aber auch durch Grausamkeit auszeichnete.
Politischer Mord an einem fünfzehnjährigen Knaben
Handelt es sich um den Racheakt linksradikaler Kreise oder sollte nur eine Spur verwischt werden?
Neue Freie Presse am 28. Mai 1924
Ein Leichenfund, der auf ein politisches Verbrechen schließen läßt, ist gestern im Dahlwitzer Forst, im Osten Berlins, gemacht worden. Ausflügler fanden dort die Leichen des 15 Jahre alten Schülers Günther Beyer, des Sohnes eines städtischen Beamten.
Die Augen waren mit einem Tuch verbunden. Der Kopf weist eine Verletzung auf, die von einem Schuß herrühren dürfte. Auf die Brust war mit einem Küchenmesser ein Zettel geheftet, der in ungelenken Zügen und merkwürdiger Orthographie die Worte aufweist: „Tod den Fascisten! Das Exekutivkomitee der kommunistischen Partei Deutschlands. Erledigt am 26. Mai 1924.“
Es fragt sich, ob die Tötung des Knaben wirklich als ein Racheakt linksradikaler Kreise angesehen werden muß oder ob man mit der Aufschrift nur die Spur verwischen und eine Täuschung hervorrufen wollte.
Das jubilierende Fiakerlied
Siegfried Loewy schreibt anlässlich des vierzigsten Geburtstages des berühmt gewordenen Liedes.
Neue Freie Presse am 27. Mai 1924
Wenn man dereinst vom Wiener Fiaker als einer vorsintflutlichen Einrichtung sprechen wird, eines der flotten Zeugel, der sogenannten „Gummiradler“, vielleicht nur mehr als Schaustück in einem Museum erblicken wird, dann dürfte den Ruhm der humorgesegneten Wiener Fiakerlenker noch immer das Fiakerlied verkünden, das vor vierzig Jahren, am 24. Mai 1884, zum erstenmal erklungen ist. Die Wiener Fiakergenossenschaft feierte um jene sorgenlose Zeit ihr hundertjähriges Jubiläum, aus welchem Anlaß die Rotunde der Schauplatz einer echten Wiener Veranstaltung war, über die der volkstümliche Geheimrat Graf Hans Wilczek das Protektorat übernommen hatte. Von ihm erfloß auch an den ihm befreundeten Finanzier Gustav Pick, der in seinen Mußestunden flotte Wiener Lieder textierte und komponierte, die Anregung, ein die Fiaker verherrlichendes Lied zu verfassen.
Für den Vortrag kam, das stand sofort bei beiden Herren fest, einzig und allein Alexander Girardi in Frage. Wenige Tage später erschien Pick bei Girardi und trug ihm die Bitte des Grafen Wilczek vor. Er spielte auf dem nicht ganz einwandfreien Klavier, das Girardi mehr als Aufputz in seinem damals noch recht primitiven Salon in der Paniglgasse stehen hatte, die Komposition vor, und - ich war zufällig bei dieser Probe anwesend - Girardi war sofort Feuer und Flamme für das Lied, erklärte sich freudig bereit, es vorzutragen.
Nur schwer war er dazu zu bewegen, in der „Tracht“ eines Fiakers zu erscheinen, den Stößer auf dem Haupt, die „Sechser“ fesch über die Schläfen gekämmt, eine karierte Unaussprechliche, dunkler Samtpanzer und eine fesch flatternde Binde um den Hals. Er meinte, die Fiaker könnten es übelnehmen, als Verspottung ansehen, wenn er nicht im traditionellen Frack, sondern in ihrer „Arbeitstracht“ erscheinen würde. Der Erfolg hat ihm unrecht gegeben, denn die zündende Wirkung des Fiakerliedes wurde durch das Kostüm nur noch gesteigert. Am liebsten hätte die große Fiakerversammlung in der Rotunde Girardi überhaupt nicht mehr von der Vortragsbühne herabsteigen lassen.
In der Tat hat der Künstler das Lied mit liebenswürdigem Humor mit unverfälschter wienerischer Färbung, und zum Schluß, als der alt gewordene Fiaker anordnet, wie er seine letzte Fahrt machen wolle (“Und kommt‘s amal zum Abfahr‘n - Ins allerletzte Haus - Da spannt‘s mir meine Rapperl ein - Und führt‘s mi ferm hinaus.“) mit warmer Empfindung bezaubernd vorgetragen. Die Fiaker bereiteten Girardi eine große Ovation, und zwei der Berühmtheiten aus ihrer Mitte führten ihn in einem feschen Gummiradler nach Hause.
Von da ab mußte Girardi das Fiakerlied, das ihm, um seine eigenen Worte zu zitieren, „schon zum Hals rauskracht“, hundert- und aberhundert Mal öffentlich und in Privatzirkeln singen, auch vor dem Kronprinzen Rudolf, vor Erzherzogen, im Salon der Fürstin Metternich usw. Mit ihm meiste mit Recht Gustav Pick für seine außerordentlich gelungene, die Wiener Note so glücklich festhaltende Komposition große Ehren ein. Nun ist das Lied allmählich verklungen, auch der Gummiradler vom „Pneumatikradler“ verdrängt worden und bald wird man vielleicht das Lied vom letzten Wiener Fiaker zu hören bekommen …
Demonstrationen vor einem Prateretablissement
Ein Orchester in einem Lokal soll Militärmärsche und andere markante Lieder aus der monarchistischen Zeit gespielt haben. Rund 100 jugendliche Sozialdemokraten marschierten daraufhin vor dem Lokal auf.
Neue Freie Presse am 26. Mai 1924
Im Gasthaus Kahrmann „zum Goldenen Kreuz“ im Prater, Ausstellungsstraße, wird bekanntlich seit einiger Zeit ein „Ochsenbraten“ veranstaltet, wobei eine bayerische Bauernkapelle konzertiert. Das Orchester soll Militärmärsche und andere markante Lieder aus der monarchistischen Zeit gespielt haben. In Arbeiterkreisen und in Arbeiterversammlungen wurde erzählt, daß diese Konzerte insbesondere von Monarchisten und Frontkämpfern viel besucht seien. In einer sozialdemokratischen Versammlung mit dem Thema „Das Urteil im Still-Prozeß“, die Freitag bei Kahrmann stattfand und in der Abgeordneter Eldersch das Wort ergriff, erwähnte sodann Gemeinderat Fischer, daß in Pratergasthäusern monarchistische Orchestervorträge stattfänden und die Arbeiter darauf ihr Augenmerk richten müßten.
Samstag nach halb 1 Uhr nachts marschierten an hundert jugendliche Sozialdemokraten vor dem Lokal Kahrmann auf. Die beim Tor postierten zwei Sicherheitswachmänner verhinderten ihren Eintritt, und auch die Gäste begaben sich zum Tor und beteiligten sich an der Abwehr der Eindringlinge. Es entstand eine Balgerei. Einer der Wachmänner kam ins Gedränge, zog den Säbel, ohne aber von der Waffe Gebrauch zu machen. Die Gäste schlugen auf die Jugendlichen los. Ein Mann wurde durch einen Stockhieb am Hinterhaupt leicht verletzt. Nach kurzer Zeit erhielt die Wache Verstärkung, und es gelang, die Demonstranten zu vertreiben. Vier Personen wurden arretiert und nach Feststellung ihres Nationales und Einleitungg der Strafhandlung entlassen. Die ganze Szene spielte sich vor dem Eingang zum Lokale ab. In das Lokal selbst kam keiner der Sozialdemokraten.
Am Sonntag abend kamen zum Lokal Kahrmann etwa 20 Nationalsozialisten und boten sich zum Schutz des Lokales an. Der Wirt lehnte diese Bewachung ab, worauf die Nationalsozialisten abzogen.
Mussolini bietet „Respekt und Freundschaft” an
„Friede um jeden Preis ist genauso absurd, wie Krieg um jeden Preis”, sagt Mussolini in einem Interview.
Neue Freie Presse am 25. Mai 1924
Mussolini gewährte dem hiesigen Vertreter der „Chicago Daily News” eine lange Unterredung, in der er auch Erklärungen über außenpolitische Fragen gab. Bezüglich der interalliierten Schulden betonte er, daß sie bezahlt werden müssen. Wer seine Schulden nicht bezahlt, verliere den Kredit, und es sei besser, alles zu opfern, als den Kredit zu verlieren.
Italien wolle zahlen, könne es aber nicht sofort. Man müsse ihm Zeit lassen, zu arbeiten und zu sparen. Auf eine andere Frage antwortete Mussolini: “Friede um jeden Preis ist genauso absurd, wie Krieg um jeden Preis. Italien hat keine aggressiven Ideen. Italien sucht für sich Respekt und Freundschaft und bietet im Austausch dafür Respekt und Freundschaft an. Italien will unbedingt zu klaren Verträgen kommen, um sein Verhältnis zu den übrigen Mächten regeln zu können, und diese Verträge müssen dann auch unbedingt und um jeden Preis eingehalten werden.”
Über den Völkerbund äußerte sich Mussolinis folgend: “Ich glaube, daß man jede Anstrengung machen muß, um das wahre Ideal des Völkerbunde zu realisieren, nämlich das Ideal des auf Gerechtigkeit aufgebauten allgemeinen Friedens. Die Welt von heute ist eine andere als die vor dem Kriege. Die ganze Menschheit hat einen weiteren Blick und ein klareres Verständnis für die Zusammengehörigkeit der Menschheit im allgemeinen gewonnen. Der Friede in Ehren, der gerechte Friede, der den Wohlstand und den berechtigten Ehrgeiz einer Nation nicht verletzt, verdient in Wahrheit das Ziel zu sein, das man anstreben soll.”
Der Flugrekord Jeanne Battens
Die Fliegerin hat die Strecke von England nach Australien in insgesamt 14 Tagen, 23 Stunden, 25 Minuten zurückgelegt.
Neue Freie Presse am 24. Mai 1934
Die junge neuseeländische Fliegerin Jeanne Batten ist heute um 14.50 Uhr lokaler Zeit gelandet. Sie hat die Strecke von England nach Australien in insgesamt 14 Tagen, 23 Stunden, 25 Minuten zurückgelegt und damit den Rekord von Amy Mollison um viereinhalb Tage unterboten.
Der letzte Teil des Fluges, der über den berüchtigten Timorsee führte, ging unter sehr ungünstigen Umständen vor sich. Die Fliegerin geriet in einen Regensturm, der sie jeder Sicht beraubte und sie zwang, längere Zeit blind zu fliegen. Sie konnte nicht einmal ihre Instrumente ablesen. Todmüde aber siegreich lächelnd stieg sie auf dem Flugplatz von Port Darwin aus der Maschine.
Miß Batten wird morgen früh nach Brisbane starten. Der geringe Aktionsradius ihres Flugzeuges macht es ihr unmöglich, über die Tasmanische See von Australien nach Neuseeland zu fliegen. Der Apparat der Fliegerin ist vier Jahre alt.
Die Gattin mit der Hundepeitsche
Eine Ehe, deren einer Teil den anderen mit der Hundepeitsche bedrohte, ist nicht scheidungsreif.
Neue Freie Presse am 23. Mai 1924
Das Zivillandesgericht und das Oberlandesgericht sind sich darüber einig, und implizite ist eigentlich damit ausgesprochen, daß die Hundepeitsche seelenruhig am häuslichen Herd lehnen kann, aber anders ausgedrückt, daß in der kleinsten Hütte außer für das glücklich liebende Paar auch für dieses Requisit zärtlicher Auseinandersetzungen Platz sein muß. Die kleine oder kleinste Hütte spielt übrigens in dem Ehescheidungsprozeß, von dem gestern in der Gerichtssaalrubrik die Rede war, gleichfalls eine Rolle. Die Ehegattin, die nicht einsehen wollte, daß der ungetreue Gatte, dem sie die nähere Bekanntschaft mit der Hundepeitsche in Aussicht gestellt hatte, es vorziehen würde, aus der lebenslänglichen Ehehaft entlassen zu werden, hat dem Gericht die wahren Gründe der Scheidungslust ihres Lebensgefährten und Prozeßgegners enthüllt.
Die Drohung mit der Hundepeitsche bedeutete dem Manne ein willkommenes Mittel, sie aus der gemeinsamen Wohnung herauszubringen, in die er dann Arm in Arm mit einer Dispensehegattin seinen triumphierenden Einzug halten wollte. Wie gesagt, seine Hoffnung bleibt unerfüllt. Die Heiligkeit dieser Ehe wird geschützt. Der Gatte wird zwar voraussichtlich durch den Prozeßausgang nicht gerade dazu bewogen werden, in sich zu gehen, und fernere Seitensprünge zu unterlassen, dafür aber wird die Gattin weiter mit der Hundspeitsche herumfuchteln, und es wird ausschließlich Sache ihres Temperaments bilden, ob es beim bloßen Fuchteln sein Bewenden haben oder ob nach dem Zivilrichter der Strafrichter zu tun bekommen wird.
Die Frauen dürften natürlich begeistert in die Hände klatschen und ihrer verdienten Vorkämpferin am liebsten eine lorbeerbekränzte Hundspeitsche als Ehrengeschenk überreichen. Aber auch unter den Männern wird es vorurteilslose Versteher der weiblichen Psyche geben, die das Vorgehen der tiefgekränkten Gattin immerhin begreiflich und verzeihlich finden dürften. Sogar, wenn sie tatsächlich zugeschlagen und sich durch solche Selbsthilfe eine bescheidene Sühne für ihr zerstörtes Lebensglück verschafft hätte, wäre man geneigt, ihr mildernde Zustände zuzubilligen. Es gibt weit schwerere „Crimes passionels“, in denen die Männer im Richtertalar ihre Geschlechtssolidarität verleugnen und die angeklagte Gattin seelenruhig freigesprochen haben.
Die österreichischen Gerichte haben sich damit begnügt, die Drohung mit der Hundspeitsche für berechtigt zu erklären, was immerhin eine bemerkenswerte Konzession an die traurige Realität der Gegenwart darstellt, in der Brutalität aller Orten Trumpf bedeutet. Unsere Richter sind eben derart überbürdet, daß sie augenscheinlich nicht noch im Redenamt auf die Verfeinerung der Lebensart, auf kultivierte Umgangsformen hinwirken können. Die Hundspeitsche ist noch immer ungefährlicher als der Gummiknüttel, und da der letztere sich bekanntlich trotz gewisser Widersprüche eine so angesehene Stellung im politischen Leben verschafft hat, scheint sich die Judikatur damit abzufinden, daß die Hundspeitsche in der Ehe als Ultima ratio zugelassen wird.
Leute, die sich wegen passender Verlobungs- oder Hochzeitsgeschenke den Kopf zerbrechen, erhalten derart einen zweckdienlichen Hinweis, wie sie ihren Verpflichtungen nachkommen können, und geschäftstüchtige Industrielle werden sicher für Hundspeitschen in luxuriöser Ausstattung Sorge tragen. Die Gegner der Dispensehe aber dürfen wieder einmal den gestrigen Tag in ihrem Kalender rot anstreichen. So weit halten wir noch lange nicht, daß zwei in Strindberg-Haß gegeneinander Lodernde auseinandergehen dürfen. Sie haben ein Kind, das nach altväterlicher Anschauung das beste Mittel darstellt, Ehebande, die sich gelockert haben, wieder fester zu knüpfen. In diesem Fall hat freilich das Kind allem Anscheine nach versagt. Aber deswegen wird hieramts die Weltordnung gepölzt. Der Rest heißt eben Hundspeitsche.
Das Märchen von einer Tochter der Kaiserin Elisabeth
Eine Gräfin Zanardi-Landi versucht jetzt aufs neue durch ihre Behauptungen die Aufmerksamkeit auf sich, vielmehr ihre neunzehnjährige Tochter Elissa, zu lenken.
Neue Freie Presse am 22. Mai 1924
Wieder taucht in englischen Blättern das Märchen von einer geheimnisvollen Tochter der Kaiserin Elisabeth von Oesterreich auf. Eine Gräfin Zanardi-Landi, die schon vor mehr als zehn Jahren die Oeffentlichkeit mit der romantischen Erzählung beschäftigt hat, sie sei eine Tochter der unglücklichen Kaiserin von Oesterreich, versucht jetzt aufs neue durch ihre phantastischen Behauptungen die Aufmerksamkeit auf sich, vielmehr ihre neunzehnjährige Tochter Elissa, zu lenken, die gegenwärtig an einem Oxforder Theater in Gilbert Cannons Stück „Everybodys Husband“ (“Der Allerweltsgatte“) den führenden Part spielt. Die junge Schauspielerin, die von außerordentlicher Schönheit sein soll, empfängt den Korrespondenten des „Daily Chronicle“ mit den Worten: „Sie wollen mich ja nur sprechen, weil eine Kaiserin meine Großmutter war. Ich bin aber nicht deshalb zur Bühne gegangen“, fügt sie hinzu. „Ich wünsche auf Grund meiner eigenen Verdienste zu reüssieren und bitte die Herren von der Kritik, mich genau so zu behandeln, wie jeden andern, der sein Debüt macht.“
Die Gräfin-Mutter ergriff gern die Gelegenheit, wieder über sich selbst sprechen zu können und tischte dem Besucher das folgende Märchen auf: „Wie Sie wissen, lebten der Kaiser und die Kaiserin von Oesterreich die letzten Jahre ihres Lebens voneinander getrennt. Meine Stellung war aber vollständig klargelegt. Schon vor meiner Geburt ist ausgemacht worden, daß das Kind, wenn es ein Knabe sei, dem Kaiser übergeben werden solle, falls es ein Mädchen würde, der Kaiserin bliebe.“ Die Gräfin erinnert dann an ihr Buch „Die Geheimnisse einer Kaiserin, enthüllt von ihrer Tochter“, das im Jahre 1913 in Italien erschien, aber dort sogleich beschlagnahmt wurde, und von dem sie sagt, die österreichische Regierung hätte die ganze Auflage gekauft und vernichten lassen, verweist dann auf ein anderes im Jahre 1915 erschienenes Buch „Ist Oesterreich verurteilt?“ in dem sie den Zusammenbruch angeblich vorausgesagt habe. „Oesterreichs Schicksal“, fuhr sie fort, „wäre ein anderes geworden, wenn Kronprinz Rudolf am Leben geblieben wäre. Ich habe die Geschichte der Tragödie von Mayerling in meinem Buche mitgeteilt und geschildert, wie man ihr mordete, weil er der Politik der reaktionären Machthaber opponierte.“
In einer im Jahre 1913 im „Daily Mirror“ veröffentlichten Unterredung hat die phantasiebegabte Dame erzählt, sie sei auf Schloß Sosseteau in der Nähe von Petites Dalles in der Normandie geboren, wo die Kaiserin unter dem Inkognito einer Gräfin von Hohenems, begleitet von dem Gynekologen Professor v. Fernwald, geweilt habe. „Meine Geburt wurde nicht registriert, weil es ein Lieblingswunsch meiner Mutter war, daß eines ihrer Kinder geheim geboren und fern von der Hofetikette erzogen werde.“ Das Mädchen wurde dann der Obhut einer Frau Kaiser übergeben, in Linz erzogen, sei öfters mit der Kaiserin auf Reisen gewesen, so 1895 auf Cap Martin, 1897 am Karersee. Im Juli 1898 ihres Kindes vollkommen klarzustellen. Bald darauf wurde sie jedoch ermordet. Leider sind sämtliche Personen, die um das Geheimnis gewußt haben, bereits gestorben, so daß die Gräfin Zanardi ihre Behauptungen nicht beweisen kann. Im Jahre 1912 will sie, die zuerst einen Leutnant Kühnelt, dann, nachdem sie in Kanada Köchin und Kellnerin gewesen, einen Grafen Zanardi heiratete, durch einen Wiener Advokaten mit Ansprüchen an den Hof herangetreten sein.
Ein Nachtigall-Konzert im Radio
Einem Ingenieur der Britisch-Broadcasting Company ist es gelungen, den Gesang von sechs Nachtigallen aufzunehmen.
Neue Freie Presse am 21. Mai 1924
Ein Triumpf der Radiotechnik, den Gesang von Nachtigallen aufzunehmen und drahtlos zu verbreiten, ist jetzt Wirklichkeit geworden. Wie die “Daily Mail” meldet, ist es Mittwoch abend einem Ingenieur der Britisch-Broadcasting Company gelungen, ein Konzert von sechs Nachtigallen in einem Mikrophon aufzunehmen und das liebliche Madrigall der Vögel an die Station “2LO” weiterzuleiten
.Und das kam so. Zu Orted, nahe London, in einem alten Haus, das von einem lieblichen Garten umgeben ist, leben drei musikalische Schwestern, die in der Gesellschaft wohlbekannte Familie Harrison. Als die drei Damen hier ihr Heim aufschlugen und mit ihren musikalischen Übungen begannen, machten sie zu ihrer freudigen Überraschung die Erfahrung, daß sich der Garten, in dem sich bis dahin nur hie und da eine Nachtigall aufgehalten hatte, von diesen Sängern bald zahlreich bevölkert wurde.
Miß Beatrice Harrison, die Cellistin des Schwesterntrios, zweifelte keinen Augenblick, daß diese Vögel die süßen Töne der Geige, den warmen Klang des Cellos, ganz besonders lieben. Die Dame fand, daß gewisse Trillerakte in Elgars, des englischen Komponisten, Cellokonzert, die befiederten Sänger besonders wirksam zum Einstimmen reizen. Im allgemeinen fällt erst ein Vogel ein, dem sich wenig später einen Halbton höher ein zweiter gesellt. Über kurzem wird aus dem Duett ein Sextett und so schwillt das Konzert zu seinem Höhepunkt an.
Mittwoch abend nun haben Capt. West, der mit der transozeanischen Radioübermittlung befaßt ist, und Mr. Palmer, der Direktor der Londoner Broadcasting Station, die Damen besucht. Miß Harrison strich ein paar Töne auf ihrem Instrument und sofort gaben die Nachtigallen Antwort. Auch eine Eule fiel ein und brachte eine weitere Tonfärbung in die eigenartige Symphonie, die von dem Mikrophon aufs glücklichste reproduziert wurde.
Heute vor 90 Jahren: Österreichs Bevölkerung wächst am Land stärker als in den Städten
Österreich hat nun 6.748.826 Einwohner.
Neue Freie Presse am 20. Mai 1934
Die vorläufigen Rohmeldungen über die Bevölkerungszahl aus allen autonomen Städten und allen Landbezirken ergeben nach der letzten Volkszählung folgendes Bild: Österreich insgesamt: Wohnbevölkerung 6.748.826, anwesende Bevölkerung 6.759.062 (+ 224.818 oder + 3,4 Prozent) gegenüber der anwesenden Bevölkerung 1923.
Die anwesende Bevölkerung hat demnach in den verflossenen elf Jahren um rund ¼ Million oder um 34 Prozent zugenommen. Große Zunahmen haben Salzburg, Kärnten, Tirol, und Vorarlberg erfahren, wenngleich in mehreren von diesen Ländern der verstärkte Grenzschutz zu einem geringen Teil die Erhöhung der anwesenden Bevölkerung bewirkt hat. Mäßige Bevölkerungszunahmen hatten Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Burgenland. Die anwesende Bevölkerung Wiens hat eine kleine Abnahme erfahren, der jedoch eine bescheidene Zunahme der Wohnbevölkerung gegenübersteht.
Für die Landesbezirke ergibt sich eine höhere verhältnismäßige Zunahme für die Stadtbezirke (+ 48 Prozent gegenüber 1 Prozent), was hauptsächlich durch die ungünstigen Zunahmeverhältnisse von Wien und Graz bewirkt wurde. Die übrigen autonomen Städte haben in der Mehrzahl eine Zunahme aufzuweisen, wie zum Beispiel St. Pölten (+ 16 Prozent) oder Klagenfurt (+11,8 Prozent). Die Umgebungsbezirke der Städte weisen infolge der Stadtrandsiedlung durchwegs stärkere Zunahmen auf.
Die Geschichte des Hakenkreuzes
Die Zeitung schreibt über die Entdeckung einer dänischen Palästinaexpedition.
Neue Freie Presse am 19. Mai 1924
Die von Direktor Gunnar Sommerfeld geführte dänische Palästinaexpedition, an deren Entdeckungsreisen in das Innere des Landes Ihr Korrespondent teilnimmt, entdeckte gestern in Kaphernaum in den Ruinen der bekannten Synagoge aus der Zeit Jesu Christi einen schönen Fries, der als Bandmotiv vier Hakenkreuze aufweist.
Damit ist ein Beweis dafür gefunden, daß das Hakenkreuz kein arischen Symbol ist, zumal andere Friese, die in den Trümmern von Kaphernaum entdeckt wurden, Hexagramme, also Zionsterne, tragen. Die dänische Expedition photographierte beide Friesarten.
Ein Telegramm von sieben Kilometer Länge
Eine der bemerkenswertesten Radiodepeschen wurde von der Kurzwellenstation des Völkerbundes gesendet.
Neue Freie Presse am 18. Mai 1934
Der „Neue Freie Presse“-Dienst meldet aus Genf: Eine der bemerkenswertesten Radiodepeschen wurde am letzten Wochenende von der Kurzwellenstation des Völkerbundes in Prangins gesendet. Es handelte sich um den bericht der Chaco-Kommission, der in englischer und spanischer Sprache an alle Regierungen des amerikanischen Kontinents gefunkt wurde. Der Bericht, der im Telegrammstil vorbereitet war, hatte eine Länge von etwa sieben Kilometer.
Die Uebermittlung begann Samstag um 23.30 Uhr und wurde um 4 Uhr unterbrochen, da die folgenden Stunden für die Funksendung ungünstig waren. Sonntag um 10 Uhr wieder aufgenommen, war die Sendung um 18 Uhr beendet. Um diese Zeit meldete Buenos Aires den Empfang des gesamten Textes. La Paz, das für derartige Fernsendungen nicht eingerichtet ist, ersuchte um Wiederholung gewisser Stellen. Diese wurde mit Erfolg Sonntag nacht und Montag vormittag durchgeführt.
Das Testament der Einbrecherkönigin
Sophie Lyons hat, aus niederen Kreisen stammend, ihre Karriere als geschickte Taschendiebin begonnen. Mit 40 entsagte sie dem Verbrecherleben und ging fortan den Weg der Tugend und Redlichkeit.
Neue Freie Presse am 17. Mai 1924
In Newyork ist vor kurzem, hochbetagt, eine ehrsame Bürgerfrau gestorben, die in ihrer Jugend ein äußerst bewegtes, vielfach durch Kerkerhaft unterbrochenes Leben führte, als verwegene Einbrecherin unter ihren Berufsgenossen nicht nur eine beherrschende Stellung, sondern auch in der Bevölkerung eine gewiße Popularität behauptete.
Sophie Lyons hat, aus niederen Kreisen stammend, ihre Karriere als geschickte Taschendiebin begonnen. Ihre Erfolge verschafften ihr in dem nicht minder erfolgreichen Kasseneinbrecher Burke einen Gatten, mit dem sie sich nun assoziierte und bald die sensationellsten Kasseneinbrüche beging. Sie pflegte als besondere Spezialität das Aufschmelzen der Panzerkassen. Ihre große Schönheit, ihre von nichts zurückschreckende Bewegtheit und ein merkwürdiges Glück machten sie ebenso gefährlich, wie sie ihre fast heroinenhafte Stellung begründeten. Wiederholt verhaftet, befreit oder entsprungen, lernte sie einmal während einer längeren Kerkerhaft einen Geistlichen kennen, dem es gelang, sie zur Ein- und Umkehr zu bewegen. Sophie Lyons war nun 40 Jahre als. Sie beschloß, ihrem bisherigen Leben zu entsagen und fortan den Weg der Tugend und Redlichkeit zu gehen.
Ihrem Entschluß ist sie bis zu ihrem Tode treu geblieben. Mit Eifer widmete sie den Rest ihres Lebens der Aufgabe, Verlorene der Gesellschaft wieder zu gewinnen. Daneben betrieb sie einen Realitätenhandel, der dermaßen florierte, daß sie bald zu Reichtum kam. Wie dankbar sich ihr das Leben der Tugend bezeigte, ist aus ihrem Testament ersichtlich, das ihr Vermögen mit nahezu 300.000 Dollar bezifferte. Es besteht in der Hauptsache aus Liegenschaften. Daneben aber wurden in einer eisernen Kasse prächtige Juwelen von seltenstem Werte, Brillanten- und Perlenkolliers, brillantenbesetzte Gold- und Silbergerätschaften, zahlreiche Ringe, ein diamantenblitzendes Kreuz, das sie bis in die jüngste Zeit getragen hatte, gefunden. Ihr Testament bestimmt vor allem eine Summe für die Errichtung eines zu ihrem Gedächtnis zu erbauenden Heimes für zwei- bis vierjährige Kinder, deren beide Eltern in Haft sind.
In einer zweiten Bestimmung bedenkt sie einen Freund aus ihrer Verbrecherjugend, den gleichfalls zu einer gewissen Berühmtheit gelangten Jesse Benterton, der eine lebenslängliche Zuchthausstrafe absitzt, mit 800 Dollar. Für etwa 850 Dollar soll ferner für die Besserungsanstalt in Detroit ein Klavier besorgt werden. 100 Dollar sind den Kranken und den zum Tode verurteilten Verbrechern in der Newyorker Strafanstalt Sing-Sing für den Ankauf von Süßigkeiten und Delikatessen gewidmet. Der Rest des mobilen Vermögens sowie die Einkünfte aus den Liegenschaften werden unter ihre drei Töchter verteilt. Der Grundstückskomplex selbst soll noch 50 Jahre ungeteilt erhalten bleiben.
Explosionskatastrophe in Ottakring
Drei “Riesenbomben” auf einem Spielfeld haben Unheil gebracht.
Neue Freie Presse am 16. Mai 1924
Ueber das folgenschwere Explosionsunglück in Ottakring liegt nunmehr nachstehende detaillierte Schilderung des Herganges vor:
Die Produktion war für 8 Uhr abends angesagt und bis auf das letzte Plätzchen ausverkauft. Der Raum für die Vorstellung war in dem oberen Teil des Sportplatzes dein Spielplatz der Fußballreservemannschaften gelegen und reichte von dem einen Goal, das an die Ziegelmauer der Garteneinfriedung des Schottenhofes grenzt, bis zum gegenüberliegenden Goal – eine Entfernung von etwa 200 Schritten. Bei der Ziegelmauereinfriedung waren die Feuerwerksfronten unmittelbar nach der Einfriedung errichtet und einige Schritte vor ihnen waren noch zwei mächtige Holzmaste für weitere Feuerwerkskörper hergerichtet, die nach deren Abbrennen umgelegt werden konnten, um die Aussicht auf die dahinterliegenden Feuerwerksfronten freizugeben.
Von den Fronten, bei denen sich der Pyrotechniker und seine Gehilfinnen aufhielten, lag ein freier Platz, an dem sich dann in der Breite des Spielplatzes in den langen Reihen die hintereinander aufgestellten Holzsitze für die Zuschauer befanden. Außer diesen zahlenden Besuchern hatte sich eine große Zahl, besonders von Jugendlichem ohne Eintrittskarten an den Zäunen, vor der Einfriedungsmauer und in den umliegenden Gärten angesammelt. Bei klarem Himmel nahm die Veranstaltung einen äußerst günstigen Verlauf, bis sich plötzlich das Unglück ereignete, das ein Menschenleben gekostet und mehrere andere Zuschauer gefährdet hatte.
Es war bereits gegen ¾ 10 Uhr nachts – für 10 Uhr war das Ende des Feuerwerks angesetzt – als, wie es auf dem Programm hieß, „fünf Riesenbomben“ abgebrannt werden sollten. Zu diesem Zwecke hatte der Pyrotechniker Zack fünf selbst angefertigte gußeiserne Mörser von beträchtlicher Länge in die Erde eingegraben, die am oberen Ende etwas aus der Erde ragten und die in ihrem Inneren mit Leuchtkörpern ausgestattet waren, die durch eine Triebmaschine emporgeschleudert werden sollten. Heinrich Zack bediente selbst diese Mörser, während seine Gehilfinnen nur beim Entzünden der kleinen Feuerwerkskörper behilflich waren. Er näherte sich nun der ersten „Riesenbombe“ und brachte sie zum Entzünden, Während er gleich nachher rücklings gegen die Gartenmauer ging, erfolgte eine Detonation und die Sache schien ordnungsgemäß zu verlaufen.
Nach zirka einer Minute Intervall näherte sich zack der zweiten Bombe und brachte auch sie zur Entzündung, um sich dann gleich wieder zurückzuziehen, ohne auf die Bombe zu blicken. Bei dieser Explosion ging es nun wie ein Ruck durch die Zuschauer, ohne daß man wußte, was geschehen sei, und man hörte vielfach die staunenden Ausrufe: „Was ist denn da los?“ Es entstand aber keine besondere Unruhe. He nun zack die dritte Bombe entzünden konnte, was nach einem neuerlichen Zwischenraum von einer Minute hätte geschehen sollen, erschollen von der dem Standorte der Bomben in den gegenüberliegenden Goals, wo die Stehplätze von den Zuschauern eingenommen worden waren, Rufe: „Wache! Wache!“
Während das Publikum nun glaubte, es sei dort zu einer Rauferei gekommen und auch Mahnungen laut wurden, doch Ruhe zu geben, eilte Wache herbei und fand dort eine Frau mit einer fürchterlichen Verletzung und blutüberströmt am Boden liegend vor. In der Hand hielt sie ihren Hut und hatte am Arm die Handtasche übergehängt. Neben ihr stand ein Mann, der an der rechten Hand erheblich blutete und der, wie sich herausstellte, der Gatte der Unglücklichen war. Die Frau war Grete Wimmer, am Vogelweidplatz wohnhaft, eine Bankbeamtensgattin, die auf der Stelle tot geblieben war. Niemand konnte im ersten Augenblicke angeben, wie sich das Unglück eigentlich zugetragen hatte, doch fand man bald darauf einen scharfsinnigen, etwa einen Quadratmeter großen unregelmäßigen Bestandteil eines der eingegrabenen Riesenbomben, der bei der Explosion in die Luft geflogen war. Das Sprengstück war, fast senkrecht aus der Luft kommend, auf das unbedeckte Haupt der Unglücklichen herabgesaust und hatte ihr buchstäblich den Kopf der Breite nach durchgeschlagen. Das gleiche Sprengstück hatte auch noch den Gatten der unglücklichen Frau Wimmer, der daneben stand, an der rechten Hand getroffen und erheblich verletzt.
Das neue Finnland
Wenn eine Wahl auf den ersten Blick so gar nichts ändert.
Neue Freie Presse am 15. Mai 1924
Was auch die moderne Demokratie sein mag: Ein immer wieder erneutes Wählen gehört jedenfalls zu ihr.
In Finnland ist am 1. und 2. April auf Grund des seit 1907 normierten allgemeinen und gleichen Stimmrechtes für Männer und Frauen und des Verhältniswahlrechts eine neue Kammer („Reichstag“) gewählt worden. Diese Wahlen hätten eigentlich erst im Sommer 1925 stattfinden sollen, doch war im Januar vom Präsidenten der Republik die im Juli 1922 gewählte Kammer aufgelöst worden, weil die sozialdemokratische Partei, die dank der Unterstützung nicht nur der industriellen, sondern auch der ländlichen Arbeiterschaft in Finnland ein einflußreicher politischer Machtfaktor ist, diese Maßnahme mit großem Nachdruck und sogar unter der Drohung des Ausbleibens aus der nächsten Kammersitzung verlangt hatte.
Die Volksvertretung war nämlich dadurch dezimiert worden, daß die Fraktion der Kommunisten durch ein gegen ihre Mitglieder eingeleitetes gerichtliches Verfahren wegen Landesverrates in Untersuchungshaft geraten war. Auf bürgerlicher Seite wollte man erst das Ergebnis des Prozesses abwarten, ein Standpunkt, der auch von der linksstehenden bürgerlichen Regierung vertreten wurde und zu ihrer Demission wie zur Bildung des gegenwärtigen Beamtenkabinetts als eines provisorischen Expeditionsministeriums führte.
Der Wahlkampf wurde, wie gewöhnlich in Finnland, von keiner besonderen politischen Frage, sondern hauptsächlich von den allgemeinen Gegensätzen der Parteien beherrscht. Es bekämpften sich somit: unter den linksstehenden Gruppen die parlamentarischen Sozialisten, die in der Partei der Sozialdemokraten vereint sind, und die offen revolutionären Kommunisten, die hier den russischen Bolschewismus repräsentieren. Unter den Bürgerlichen standen sich die rechts-gerichteten, deren finnischsprechender Teil von der sogenannten Sammlungspartei vertreten wird, und die links-gerichteten gegenüber, die auch das bürgerliche Zentrum genannt werden und aus der „Fortschrittspartei“ und der Partei der Kleinbauern bestehen. Dazu kam, wie immer, die schwedische Partei, in der sich das schwedisch-sprechende Neuntel der Bevölkerung Finnlands politisch zusammengeschlossen hat.
Es hängt mit dem zähen, sachlichen, wenig aufwallenden Volkscharakter zusammen, daß Neuwahlen in Finnland in der Vertretung der verschiedenen Parteien nur unbedeutende Verschiebungen hervorzubringen pflegen. Das war auch jetzt der Fall.
Anmerkung: Die elfte Wahl zum finnischen Parlament fand Anfang April 1924 statt, nachdem die 27 Abgeordnete der Sozialistischen Arbeiterpartei im August 1923 wegen angeblichen Landesverrats verhaftet wurden und Präsident Kaarlo Juho Ståhlberg die Auflösung des Parlaments verordnet hatte. Das Sozialistische Arbeiter- und Kleinbauernwahlbündnis trat für die Sozialistische Arbeiterpartei bei der Wahl an, verlor jedoch neun Sitze. Davon profitierten in die Sozialdemokraten, die vor dem Landbund, der nur leicht verlor, klar die stärkste Kraft blieben. Erstmals seit drei Jahren entstand in der Folge eine Mehrheitsregierung.
Wie steht es heuer um die Minne von Meister Lampe?
Über Jagdansichten in Österreich-Ungarn.
Neue Freie Presse am 14. Mai 1924
Ein Jäger schreibt uns: Der Wonnemonat Mai hat sich in Oesterreichs Landen gar nicht gut eingeführt, ja die Fostperiode gleich zu Beginn des Monats verursachte der Landwirtschaft, noch mehr aber dem Weinbauern großen Schaden. Obst- und Weinbau erlitten in einer Zeit, wo die schönsten Hoffnungen vorhanden waren, schwere Schäden, die kaum mehr zu heilen sind. Ein paar Stunden Tieftemperaturen, ein Eishauch, der über die Landen strich, bereiteten der Landwirtschaft für ein ganzes Jahr enorme Verluste. Gleich wie der Landwirt hat auch der Jäger gar sehr mit Wettergunst und -ungunst zu rechnen: auch er bangt und sorgt das ganze Jahr für seinen Wildstand, den der nächste Wettersturz, die heraufziehende Hagelwolke, eine Regenperiode oder Dürre zu vernichten vermag.
Bis jetzt hatte sich das Frühjahr noch gnädig gezeigt für den Wildstand, namentlich für das Niederwild. Junghasen gab es wohl schon von Mitte Februar ab in sehr geschützten Lagen: man fand sie in den Düngerhaufen der Feldfluren, wo sie vor dem harten Winter weiter am besten geschützt waren. Die meisten Junghasensätze brachte jedoch der Monat März: die sogenannten „März-Hasen“. Sie sind es, mit denen der Jäger als Zuwachs vor allem rechnet. Tritt durch mildes Wetter verführt, Meister Lampe gar zu früh in die Minne, so daß die ersten Hasensätze noch im Machtbereiche des Winters ihr kurzes Erdendasein beginnen, so ist die Einbuße schon von vornherein eine große, wird aber eine katastrophale, sobald auch im vorgeschrittenen Frühjahre Wetterstürze eintreten, die die letzten Reste des ersten Satzes und den in die Welt gesetzten zweiten Saß mitvernichten.
Der strenge Winter aber, in den Niederwildrevieren wohl nicht von zu reichlichen Schneemengen begleitet, ließ Meister Lampe nicht recht zu vorzeitiger Minne kommen: dies rettete Tausenden von Junghasen das winzige Leben auf den Flüren Nieder- und Oberösterreichs, Mährens, Böhmens und Ungarns. Auch die Südsteiermark und Galizien haben einige gute Hasenjagdgebiete, in welchen heuer die junge Deszendenz ganz prächtig nachwächst. Im Tullner Boden und im Marchfelde erwartet man heuer ein sehr befriedigendes Hasenjahr. Aehnliches ist vom Feldhuhne und dem Fasan zu sagen. Das Rebhuhn befindet sich augenblicklich in der Lege- und Brutperiode, desgleichen der Fasan.
Während sonst nach Winterausgang manche Fasanerkrankungen und in der Folge auch epidemische Erkrankungen gemeldet wurden, ist bislang noch nichts bekannt. Der Jungfasan, der in nicht gar langer Zeit die Fasanerien bevölkern wird, kann dahingerafft werden, sobald er ins Leben getreten ist und erliegt gar leicht mancherlei Krankheiten. Dagegen sind die Rebhühner schon gefährdet kurz nach dem Paaren.
Die letzte Blaue
Der 1. Juni wird unter Umständen im Kalender eines jeden Straßenbahninteressenten rot angestrichen werden.
Neue Freie Presse am 13. Mai 1924
Damit wäre weniger eine parteipolitische Huldigung für die gegenwärtigen Machthaber im Rathaus beabsichtigt, als vielmehr dem inneren Drang Ausdruck verliehen, den Tag anzumerken, von dem angefangen auch die Straßenbahner sich endlich davon überzeugen ließen, daß der Weltkrieg, genau genommen, doch zu Ende gegangen sei. Die „letzte Blaue“ soll eine Stunde später verkehren, ganz so wie im tiefsten Wiener Frieden.
Man soll wirklich nicht mehr dazu verurteilt sein, im Theater oder im Konzertsaal zum eigenen Mißvergnügen und zu dem der übrigen Besucher vor Schluß wegzueilen, in der Garderobe Carpentier nachzuahmen, damit man doch vielleicht die Eventualität vermeide, bei Wind und Wetter seine Wohnung in irgendeinem entfernten Stadteil zu Fuß aufsuchen zu müssen. Es winkt die verführerische Aussicht, an heißen Sommerabenden - vielleicht wird es auch heuer solche geben - in die Umgebung Wiens hinausfahren zu dürfen, ohne einige Atemzüge Wienerwaldluft mit einem stundenlangen Fußmarsch zu bezahlen. Aber nur nicht übermütig werden! Mit dem Triumphgeschrei lieber ein wenig zuwarten! Noch ist es nicht viel mehr als eine zittrige Hoffnung, als ein vielversprechendes: Es dürfte! Es könnte! Als ein freundlich zwinkerndes: Vielleicht!
Jawohl, wir werden aller Voraussicht nach in irgendeiner Zukunft wieder zu dem Rang einer x-beliebigen Provinzstadt emporklettern, in der die Straßenbahnen bis Mitternacht verkehren, hier und dort sogar darüber hinaus; aber es ist noch keineswegs ausgemacht, ob das tatsächlich bereits in vierzehn Tagen der Fall sein wird. Noch sind nicht alle Schwierigkeiten behoben; noch wird beraten und verhandelt. Noch ist es nicht gelungen, den Straßenbahnern mundgerecht zu machen, daß die von ihnen geheischte Mehrleistung nicht etwa Nichtstuern und Nachtschwärmern zugute kommen soll, sondern im Lebensinteresse der arbeitenden Gesamtbevölkerung gelegen ist.
Von der Rathausgewaltigen darf man jedoch voraussetzen, daß sie hier die Rücksicht auf billige Popularität und auf Wählergunst in den Hintergrund stellen werden. Sie müssen sich sagen, daß keine Parteiangelegenheit auf der Tagesordnung steht, daß man unter Umständen den Mut zu einer Entscheidung aufbringen muß, die von jenen, denen sie neue Arbeitslast aufbürdet, mit ärgerlichem Brummen aufgenommen wird. Weder der reaktivierte Hochstrahlbrunnen, noch die Blumenkörbe an den Leitungsmasten werden den Wiener Kommunalsteuerzahler davon überzeugen, daß Wien die bestverwaltete Stadt ist, solange schwächliche Liebdienerei nach unten für die Wiener Verkehrsbedürfnisse nichts übrig hat als Projekte und vage Besprechungen.
Fünfundzwanzigtausend Dollar für das Monster von Loch Ness
Der Direktor des New Yorker Zoologischen Gartens will das Monster lebend.
Neue Freie Presse am 12. Mai 1934
Eine nette Gelegenheit, zu einem schönen Stück Geld zu kommen. Schließlich sind fünfundzwanzigtausend Dollar nicht zu verachten. Sogar wenn man die Dollarentwertung in Betracht zieht. Und dieses Geld liegt auf der Straße. Nein, das ist wieder zu viel behauptet. Wohl aber liegt es im See von Loch Neß.
Der Direktor des New Yorker Zoologischen Gartens will durchaus die persönliche Bekanntschaft eines Seeungeheuers machen und verspricht demjenigen, der ihm seinen Herzenswunsch erfüllt, eine Geldprämie in der angegebenen Höhe. Freilich sind noch einige Nebenbedingungen zu erfüllen. Für ein totes Seeungeheuer gibt der Herr Direktor keinen Cent. Man muß es also lebend fangen und es gesund und wohlbehalten im New Yorker Zoologischen Garten abliefern. Wer sich also etwa einbildet, den Schillerschen “Kampf mit dem Drachen” aufzuführen und an ein gutausgestopftes Seeungeheuer nach Newyork zu schicken, der befindet sich auf dem Holzweg.
Er muß dem Monster anders beikommen, muß es in eine Falle locken oder ihm Salz auf den Schweif streuen oder eine sonstige erprobte Methode der Vogelfänger anwenden. Dann aber erwächst ihm die Pflicht, das Seeungeheuer bis zu seiner Ankunft entsprechend zu verpflegen, was umso schwieriger ist, weil über die Kost, die von Seeungeheuern bevorzugt wird, nichts Gewisses bekannt ist.
Bei dem genauem Studium der Bedingungen des Preisausschreibens kommt man darauf, daß auch ein gut erhaltenes, sich der besten Gesundheit erfreuendes Seeungeheuer dem Herrn Direktor nicht unter allen Umständen zufrieden stellt. Er verlangt, daß das Monster mindestens zwölf Meter in der Länge messe. Armer Monsterfänger. Jetzt hat er richtig ein Seeungeheuer drangekriegt, nimmt das Zentimetermaß zur Hand und bemerkt zu seinem Schrecken, daß es nur elf Meter neunundzwanzig Zentimeter mißt. Da bekommt er einen roten Kopf und wirft das Monster einfach wieder in den See.
Wer weiß übrigens, ob sich nicht die Hotelbesitzer von Loch Neß, die durch das Seeungeheuer zu reichen Leuten geworden sind, energisch zur Wehr setzen und im englischen Parlament eine Bill zur Annahme bringen werden: Loch Neß wird hiermit zum Naturschutzpark erklärt. Seeungeheuer darf man weder füttern noch reizen, und das Fangen von Monstern ist bei Geld- und Arreststrafe strengstens verboten.
Wie das Wetter, so die Wirtschaft?
In Österreich kann man derzeit alle möglichen Wetterspielarten beobachten.
Neue Freie Presse am 11. Mai 1924
In der Prognose vom Freitag, in der für gestern Regen vorausgesagt war, hieß es trostvoll: „Sonntag wahrscheinlich schon wieder Bewölkungsabnahme.“ Der Samstag hat leider redlich gehalten, was der Freitag versprochen hatte, und man konnte alle Spielarten des Regens studieren.
Bald tröpfelte aus trostlos gramen Gewölk eintönig der Schnürlregen, dann goß es in Strömen, als würden Riesenkübel auf die bedauernswerten Passanten herabgeschüttet. Wollte man aus dem platzregenartig senkrechten Wassersturz schon die Hoffnung auf baldige Aufheiterung ableiten, so warf eine Winddrehung diese Kombinationen über den Haufen und in schiefen Strichen spritze einem ein richtiger Landregen ins Gesicht. Hat die Wetterprognose für Samstag nur allzu recht behalten, so wünscht man sich um so mehr zur Entschädigung, daß ihre optimistische Schlußpointe, die dem Sonntag galt, ebenfalls in Erfüllung gehe.
Von einem Wetterfachmann wurde uns in später Nachtstunde mitgeteilt, daß die Aufheiterung aus Westeuropa mit Riesenschritten zu uns marschiere und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon in den Sonntag frühlingshelles Maiwetter verspreche. Den geplagten Wienern, die jetzt ohnedies schwer genug unter der Wirtschaftskrise seufzen, ist es wirklich zu gönnen, daß sich wenigstens das Wetter endlich ihrer erbarme.
Die Riesenkonditorei im Operntheater
Dies ist der Ort, an dem Naschfantasien wahr werden – trotz Wirtschaftskrise.
Neue Freie Presse am 10. Mai 1924
Die Naschkatzen beiderlei Geschlechts konnten heute in Süßigkeiten schwelgen. Die Riesenkonditorei, deren Warenvorrat an feinen Süßigkeiten und hausgemachten Mehlspeisen lebendig wird, ist nicht nur der Wunschtraum eines kleinen Firmlings, sondern die Likörweichseln, Ananastorten und Himbeerkuchen, die sich zwei Stunden lang auf der Bühne im Reigen ergehen, bedeuten manchem Leckermäulchen die Verkörperung naschhafter Phantasien.
Die Ausführung im Rahmen der Richard Strauß-Feier hat durchaus den Charakter einer Sensationspremiere. Trotzdem wirft die schwere Wirtschaftskrise, in der sich Wien gegenwärtig befindet, ihre Schatten auch auf dieses festliche Haus.
Man sieht in den Sitzreihen ab und zu einen freien Platz, ein Anblick, der bei einem Theaterereignis dieser Art einigermaßen ungewohnt wirkt. Auch ist von jenem beinahe aufdringlichen Toilettenluxus, wie er beispielsweise beim Théatre paré zu beobachten war, nichts zu merken. Man empfindet es beinahe als wohltuend, daß die gar zu grelle Pracht, die während des heurigen Faschings viel Widerspruch erweckt hat, gedämpft ist und Exzesse des Luxus vermieden sind.
Ist das Bild im Zuschauerraum nicht ganz so farbenprächtig, wie man es von anderen Sensationsveranstaltungen in Erinnerung hat, so bietet die Bühne einen Anblick von mächtiger Kostümbuntheit. In zarten Abtönungen vereinigt sich ein Spitzengeriesel mithauchfeinen Wolken von Tüll und Schleiern und einer phantastisch schillernden Vielfalt von Phantasiegewandungen zu einer schilldernden Farbensymphonie.
Reizend ist die „Likörweichsel“, deren Darstellerin in einem regenbogenbunten Kleide ans Spitzen und Seide, mit faustgroßen Weichseln verziert, eine Riesenweichsel als Kopfputz trägt. Auch die kandierten Früchte machen den Zuschauernden Mund wässern, Prinz Zucker sieht wie ein Riesenzuckerhut aus und trägt Bänder, die mit Würfelzuckerstücken verziert sind. Drollig sind die Zwetschkenkrampusse in ihren grau-schwarzen Kostümen, deren Gliedmaßen in regelmäßigen Abständen abgebunden sind, so daß sie jenen leckeren Figuren die man zum Nikolotage bei allen Zuckerbäckern sieht, wirklich täuschend gleichen.
Keine Spur von Nachkriegsmisere in London
Wer London besucht, wird von dem Eindruck des Luxus und des Reichtums überwältigt sein.
Neue Freie Presse am 9. Mai 1934
Aus London wird uns geschrieben: Wenn England seine Sorgen und Schwierigkeiten hat, so weiß es sie gut zu verbergen. Wer London in diesen Tagen der Season besucht, muß jedenfalls von dem Eindruck des Luxus und des Reichtums, der sich Tag wie Nacht strahlend entfaltet, überwältigt sein. Krieg und Nachkriegsmisere? Vergessen oder überwunden, ausgelöscht.
London hat wieder sein Nachtleben in jener Großartigkeit, deren es sich in der guten alten Zeit erfreute. Die warmen Maiabende tun das ihrige, die Stimmung der Sorglosigkeit und des leichten Geldausgebens zu begünstigen. Auf den vornehmen Straßen und in den Nobelrestaurants pulsiert das Leben der eleganten Welt - wie einst im Mai der Vorkriegsjahre.
Namentlich im Theaterviertel, wo das Publikum die längere Nachtmahlpause gern nützt. So kann man noch am Tag - denn bis 21 Uhr ist es noch licht - im Piccadilly und Strand Prozessionen von schönen Frauen in prachtvollen Abendtoiletten mit edelsteingeschmückten Tiaras und elegante Herren im Smoking oder Frack vom Theater in die Restaurants zurückgehen sehen. (...)
Geld ausgeben und zeigen, daß man es tut, Luxus- und Prachtentfaltung vor den Augen der Öffentlichkeit, um ein weithin sichtbares Beispiel zu geben - das ist die Devise, die den Charakter der diesjährigen Season in London bestimmt.
War Schillers Vater ein Alkoholiker?
Wenn im Nationalrat das Privatleben eines Schriftstellers besprochen wird.
Neue Freie Presse am 8. Mai 1924
Friedrich Schiller mußte gestern im Nationalrat als Eideshelfer für den Mutterschaftszwang herhalten. Die Frauen sollen auch fernerhin Gebärmaschinen bleiben und Kinder, deren Dasein auf einen brutalen Vergewaltigungsakt etwa zurückzuführen ist, Kinder ferner von Wahnsinnigen und von Syphilitikern müssen zur Welt kommen, weil der Vater Friedrich Schillers angeblich ein Alkoholiker gewesen sein soll.
„Ein Alkoholiker höchsten Grades“, meinte der Abgeordnete Jerzabek, der sonst genealogische Studien höchstens in jenen Fällen betreibt, wo es ihm darauf ankommt, einen sogenannten Judenstämmling schonungslos zu entlarven. Einer der Redner von der Gegenseite trat Herrn Jerzabek mit gebotener Vorsicht entgegen. Die Ehrenrettung Schillers Seniors hörte sich allerdings einigermaßen reserviert an. Es mag richtig sein, daß Schillers Vater viel getrunken hat, meine dieser Grosso-Verteidiger, aber es geht demnach nicht an, ihn geradezu als Trunkenbold hinzustellen.
Begütigend fügte der Redner hinzu, Vater Schiller sei alles in allem genommen, ein Mann von ungewöhnlich hohen Fähigkeiten gewesen. So ist denn der wackere Leutnant, Feldscher und Werbeoffizier Kaspar Schiller im österreichischen Nationalrat mit einem blauen Auge davon gekommen. Eigentlich ist es aber gar nicht schön von dem christlichsozialen Abgeordneten Jerzabek, sich mit solcher Rücksichtslosigkeit in das Privatleben des alten Herren einzumischen.
Vater Schiller war ein ungemein frommer und religiöser Mann, der während seiner Kriegsdienste oft und oft den Feldgeistlichen supplierte und sogar eine Anzahl von Gebeten in Prosa und in Versen verfaßt hat.
Wahrscheinlich waren es seine soldatischen Abenteuer und seine Kriegsdienste, die in verleiteten, tiefer ins Glas zu schauen, als es wünschenswert gewesen wäre. Aus seinen Briefen an den großen Sohn jedoch, der selbst in seinen kraftgenialischen Jahren kein Kostverächter gewesen ist und bei Gelagen mit befreundeten Offizieren manchmal sogar unter den Tisch getrunken worden sein soll, spricht alles eher denn der Leichtsinn und die göttliche Sorglosigkeit des Trinkers.
Keinesfalls aber wird man Herrn Dr. Jerzabek unbedingt zustimmen können, wenn er Friedrich Schiller selbst gegen die moderne Auffassung vom Rechte der Frau auf Selbstbestimmung ausspielt. Angenommen, aber nicht zugegeben, daß Schillers Vater wirklich ein Alkoholiker gewesen sei, so würde daraus auf keinen Fall geschlossen werden können, daß es für die Volkswohlfahrt besonders zuträglich wäre, wenn Alkoholiker, Syphiliker und Wahnsinnige möglichst viele Kinder in die Welt setzen. Der gewissenhafte Arzt, der dem von einer unheilbaren krankgeit Heimgesuchten das Gegenteil des Bibelwortes: „Seid fruchtbar und mehret euch!“ zur Pflicht macht, wird sich kaum durch den Hinweis auf Friedrich Schiller und seinen Vater irre machen lassen.
Österreich darf sich nicht ausruhen
Die wirtschaftlichen Zeiten sind zu schwierig, um eine Atempause zu gestatten.
Neue Freie Presse am 7. Mai 1934
Das Wort, daß nach getaner Arbeit gut ruhen sei, darf gegenwärtig in Österreich keineswegs buchstäblich genommen werden. Wohl ist in der letzten Zeit viel geleistet worden. Doch die Arbeit, die hinter uns liegt, verpflichtet zu weiterer ernster Tätigkeit. Die Zeiten sind zu schwierig, um eine Atempause zu gestatten, ein selbstzufriedenes Verweilen bei dem Vollbrachten.
Es gilt vielmehr, sogleich an die Fortsetzung der bisherigen Wirksamkeit zu denken und aus den Ergebnissen der jüngsten Vergangenheit die trostreiche Zuversicht zu ziehen, daß dem Mutigen, dem Unternehmungslustigen selbst heute der Erfolg winkt, mag ihm auch nicht mehr die Welt gehören. Eines steht fest: Neben dem verfassungsrechtlichen und politischen Werk dürfen die Bemühungen um die Befruchtung, Stärkung und Unterstützung der Wirtschaft nicht zu kurz kommen.
Durch die Bankenfusion wurde der finanzielle Apparat umgestellt. Aus seiner Zusammenfassung ergibt sich leider die harte Notwendigkeit, den Beamtenkörper den geänderten Verhältnissen anzupassen. Allein dieses schwierige Problem kann nur dann richtig gelöst werden, wenn man den menschlichen Empfindungen gebührend Raum gewährt und wenn man bei der Aktion auf die Interessen der Gesamtheit Bedacht nimmt. Jede vermeidbare Verringerung der Konsumationskraft der Bevölkerung soll eben behutsam hintangehalten bleiben.
Eine schonungsvolle und verständnisvolle Behandlung erheischt auch die Zusammenlegung von Industriebetrieben, mit der man sich in der nächsten Zukunft prinzipiell und praktisch befassen wird. Jeder Mißgriff, jede Übereilung würde sich hier bitter rächen, denn es ist leicht, niederzureißen, aber schwer, aufzurichten. Als Hauptaufgabe muß jedoch die positive Förderung, die Belebung der Wirtschaft durch neue Impulse angesehen werden.
Ein Skandal weniger
Kleine und große Unsäglichkeiten sprießen derzeit aus dem Boden.
Neue Freie Presse am 6. Mai 1924
Ein Skandal ist aus der Welt geschafft worden. Oder wird wenigstens, wenn nicht alle Anzeichen trügen, in naher Frist von der Bildfläche der öffentlichen Diskussion verschwinden. Das ist immerhin bemerkenswert, in einer Zeit, da die Skandale, die gigantischen Riesenskandale und die kleinen niedlichen Skandälchen mit einer Ueppigkeit aus dem Boden schießen, wie die Pilze eines solche im feuchten Sommer nicht aufzuweisen haben. Wir meinen den Seeschlangenprozeß, den der ehemalige Theaterdirektor Amann seit Jahr und Tag gegen das Aerar zu führen genötigt ist, weil sogar ein Vierundachzigjähriger, mag er auch seine Ansprüche an das Leben ein auf ein Minimum beschränkt haben, mit 10.000 K. jährlich sein Auskommen nicht zu finden vermag.
Der Theaterdirektor hatte ein ihm gehöriges Heilbad einer Stiftung gewidmet, die für Militärwitwen und Militärwaisen bestimmt gewesen ist. Eine schöne Geste, die dadurch nicht beeinträchtigt wurde, daß der brave Mann, wenn auch dem Sprichwort getreu, zuletzt an sich nicht vollkommen vergaß und bis zu seinem und seiner Gattin Lebensende eine Jahresrente von 10.000 K. sich vorbehalten hatte. Ach ja! Es gab so eine Zeit, wo man zu sorgen aufgehört hatte, wenn man die stolze Gewißheit besaß, jahraus jahrein 10.000 K. einstreichen zu dürfen. So dachte auch der Herr Amann und er mag sich seinen Lebensabend wundernett vorgestellt haben. Da kam der Weltkrieg, der durch so viele Rechnungen hindurch blutige Striche machte.
(…) Er, der gespendet und aus vollen Händen gegeben hatte, sah sich über Nacht in die Rolle des läßtigen Bittsteller, des ohnmächtigen Bettlers verwiesen. Das Aerar war allerdings nicht kontraktbrüchig geworden. Gott behüte! Es zahlte vereinbarungsgemäß 10.000 K. Jahresrente und es zuckte überlegen die amtlichen Achseln bei dem Vorhalt, daß es genau genommen doch nicht mehr ganz dieselbe Rente sei. 10.000 K. Jahresrente, das ist heutzutage nicht nur zum Leben, sondern sogar zum Sterben zu wenig. Aber darüber ließ man sich hieramts, wie gesagt, keine grauen Haare wachsen.(...) Erst sehr spät scheint man auf den naheliegenden Gedanken gekommen zu sein, daß ein Ausgleich mit dem 84jährigen Greis den Staat aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ruinieren dürfte, daß das ganze Vorgehen gegen Herrn Amann alles genannt werden könne, nur nicht nobel. Dieser Mann hat denn doch verdient, mit einem anderen Maß gemessen zu werden, als seine Schicksalsgenossen, als alle jene, deren Ideal die Valorisierung ist. Die Republik Oesterreich, die sich sonst von den Sentimentalitäten des Festhaltens an Traditionen ganz gut verstand, hat überflüssigerweise bei dieser Gelegenheit ein Wort aus der Francesco-Josefinischen Zeit sich zu eigen gemacht, das Wort des Fürsten Schwarzenberg: Die Welt wird staunen, wie undankbar wir sein können!
Notruf der Frauen in Südtirol
Die deutsche Sprache soll in den Volksschulen erhalten bleiben.
Neue Freie Presse am 5. Mai 1924
Wie gemeldet, hat eine Abordnung deutscher Frauen dem italienischen Kronprinzen bei dessen Besuch in Bozen eine Schrift überreicht, in der sie ihn baten, für die Erhaltung der deutschen Unterrichtssprache in den Volksschulen ein einzutreten. In der Bittschrift heißt es:
„Die Verdrängung der deutschen Sprache aus den Schulen des Alto Adige bereitet uns Frauen so viel Sorge und Kummer, daß wir auch heute vor Eurer königlichen Hoheit wiederum die dringliche Bitte vorbringen müssen, uns das Heiligte, was ein Volk besitzt, seine Muttersprache, ungeschmälert zu belassen und sohin den Volksschulunterricht in der Muttersprache wieder herzustellen.
Eure königliche Hoheit der erlauchte Sproß eines alten Königsgeschlechtes, wird es gewiß als Pflicht der Menschlichkeit und des Edelsinnes empfinden, ein kleines, anderssprachiges, in die Grenzen Italiens ein eingeschlossenes Volk nicht unterdrücken zu lassen.
Ihr Wunsch kann es nur sein, daß alle Bewohner des Staates sich in demselben wohl fühlen und sich gegenseitig nähern, und gewiß würde nichts mehr dazu beitragen, die bei den Nationen zu gemeinschaftlicher Arbeit für das Wohl des ganzen Landes zu vereinigen, als die Gewißheit, daß es auch uns Deutschen möglich gemacht wird, unseren Kindern in erster Linie die Kenntnis der Muttersprache voll zu erhalten; wenn wir dessen sicher wären, würden unsere Kinder mit ganz anderem Eifer auch der Erlernung der italienischen Sprache sich widmen können.“
Mussolini und Machiavelli
Der Italiener will an der Universität promovieren.
Neue Freie Presse am 4. Mai 1924
Mussolini soll am 15. Juni zum Doktor der Universität Bologna, promoviert werden und hat der Universität eine Dissertation über Macchiavelli vorgelegt. Die Einleitung zu, dieser Dissertation wird jetzt von der faschistischen Zeitschrift “Gerarchia” veröffentlicht.
Mussolini untersucht die Frage, welcher lebendige Gehalt nach vier Jahrhunderten von Macchiavesllis “Principe” noch enthalten sei. Nach seiner Ansicht sei die Lehre Macchiavellis heute noch viel lebendiger als in der Vergangenheit. Interessant ist, wie Mussolini unter Beziehung auf die von Machiavelli im “Principe” geäußerten Ansichten die menschliche Natur beurteilt.
Mussolini sagt: “Schon bei einer oberflächlichen Lektüre des ‘Principe’ tritt deutlich der scharfe Pessimismus Macchiavellis hinsichtlich der menschlichen Natur hervor. Wie alle jene, welche in fortwährendem Verkehr mit ihren Nebenmenschen gestanden haben, ist Macchiavelli ein Verächter der Menschen und liebt es, sie in ihrer negativsten Gestalt darzustellen. Die Menschen sind nach Macchiavelli mehr den Dingen als ihrem eigenen Blute zugetan und bereit, Gefühle und Leidenschaftenzu ändern. Viel Zeit ist seither vergangen, aber wenn es mir erlaubt wäre, meine Zeitgenossen zu beurteilen, könnte ich in keiner Weise das Urteil Macchiavellis mildern, sondern müßte es noch verschärfen.”
An die Stelle des Wortes “Principe” müße man heute die Bezeichnung “Staat” setzen. Während die Individuen von ihrem Egoismus getrieben, dem sozialen Aktionismus zustreben, stelle der Staat eine Organisation und eine Begrenzung dar. Das Individuum strebe unaufhörlich danach, sich seinen Verpflichtungen zu entziehen, den Gesetzen nicht zu gehorchen, keine Steuern zu zahlen und keine Kriege zu führen.
Mussolini wendet sich hierauf im Sinne seiner bekannten Anschauungen gegen die Volkssouveränität, die er als einen tragischen Spaß bezeichnet, und erörtert dann die Anschauungen Macchiavellis über die Demokratie.
Die japanische Kaiserin kommt zu Besuch
Wer hätte sich gedacht, dass eine Herrscherin zu einem Kranken kommen würde?
Neue Freie Presse am 3. Mai 1924
Aus Jokohama wird uns geschrieben: In Numadfu war‘s. Einem kleinen Städtchen am Flusse Kannongawa. Im April, wenn in Nippon die Kirsche blüht. Die Aufregung auf der alten Tokaido, der Heerstraße, an der Numadfu liegt, war nicht zu verkennen. Ein Hasten und Laufen, Polizisten, die Befehle erteilten, Frauen, die die Straßen sprengten, Schulkinder, die sich zu beiden Seiten ins Spalier stellten. „Was gibt‘s? Wem gelten die Vorbereitungen?“ „Kogo hcka!“ Ihrer kaiserlichen Majestät. So hieß sie im Volke.
Wie alle ihre Vorgängerinnen seit dreihalbtausend Jahren. Nie wurde ihr Name genannt. Kaum wußte man, daß sie Haruko - der Frühling -hieß. Am Ende des Städtchens Numadsu wohnte ein japanischer Aristokrat; er lag damals am Fieber danieder. Und die Kaiserin hatte ihm ihren Besuch zugesagt. Mit Fahnen und violetten Vorhängen - violett ist die Farbe des Kaiserhauses - war die Wohnung des kranken Barons dekoriert. Vor dem Eingangstor hatte ein Schintopriester Ausstellung genommen, in gelbseidener Robe, das Holzszepter in der Hand. Um ihn herum die Schulmädchen in lila und bordeauroten Kimonos, ein glänzendes, orientalisches Bild. Ein Reiter, in Gehrock und Zylinder, kommt die Straße herabgesprengt. Ihm folgt, in weitem Abstand, die goldrote Hofequipage.
Einfach, schlicht, keine Spur von asiatischem Prunk. Drei Damen steigen aus, stellen sich rechts und links vom Wagenschlag auf. Dann eine Sekunde der Erwartung - und die Kaiserin entsteigt dem Innern der Equipage. In europäischem Kostüm: meergrünes Reisekleid, kleiner Hut, schwarzer Schleier. Langsam, sicher, nicht ohne Grazie bewegt sie sich durch das Spalier der sich tief neigenden Hofdamen.... Das also ist sie, die Gattin Mutsuhitos, die dem um zwei Jahre jüngeren Herrscher als achtzehnjähriges Mädchen angetraut worden war. Wie hat sich doch alles von Grund ans geändert seit dem Tage, da, die Wahl des Hofes auf sie als zukünftige Kaiserin fiel.
Damals war Japan noch ein feudaler Stadt. Die Zweischwertmänner herrschten noch im Lande und mehr als einmal hallten die weiten Säle des friedlichen Palastes in Kyoto vom klirrenden Schritt der Samurai, von Schwertarklang und Kriegsruf wider. Wilde Tage waren das, die dem endgültigen Sturze des allmächtigen Schoguns vorangingen! Schon sprachen zwar alle Zeichen dafür, daß der Sieg sich auf die kaiserliche Seite neigen werde. Daß der Mikado wieder eingesetzt werden würde in seine Herrscherrechte, die er, vor sieben Jahrhunderten, an die Adelsfamilie der Minamoto verloren hatte. Und doch, wer der jungen Haruko damals prophezeit hätte, daß sie eines Tages in schlichter Equipage in das Haus eines kranken Barons fahren würde, er wäre wohl für geistig nicht normal gehalten worden. Denn allgemein glaubte man damals, der Sturz des Schoguns würde die Wiederherstellung jener Zustände im Gefolge haben, wie sie vor dem Zwölften Jahrhundert gegolten hatten: ein zentralisierter Beamtenstaat, abgeschlossen gegen die Außenwelt, mit dem Mikado als alleinigem, aber dem Volke zeitlebens unsichtbarem Herrscher, dessen bloßer Anblick sterbliche Augen erblinden läßt.
Es kam anders, ganz anders. Die klugen Männer, die an der Spitze der Bewegung von 1867 standen, wußten mit den Institutionen des zwölften Jahrhunderts nichts anzufangen. Allzu laut, allzu ungestüm pochten Europa und Amerika an Nippons verschlossene Torei, verlangten Einlaß, drohten mit Gewalt. Die Zeit des Abschlusses, des Dornröschenschlafes war unwiederbringlich dahin. Mit dem Strome schwimmen, hieß es, oder in seinen Wellen untergehen. Und die Führer der Nation wählten das erstere. Auch sie, die Kaiserin aus dem Hause Fudschiwara, wurde mit Hinsingerissen in den Wirbel. Als der Mikado, unter dem starren Staunen seines Volkes, das tausendjährige Kyoto, die heilige Kaiserstadt, verließ und nach Norden zog, nach Tokio. Und als mit zunehmender Europäisierung Japans eine Mauer um die andere fiel, die zwischen Herrscher und Volk gestanden hatte, da trat auch die Kogo aus dem heiligen Dämmer der Abgeschlossenheit heraus ins helle Tageslicht der Öffentlichkeit. Mit natürlicher, ruhiger Grazie. Als wäre sie von Jugend auf dazu erzogen worden, vor allem Volke zu repräsentieren.
Die Schlafkrankheitsepidemie in England
In der Hauptsache sind junge Menschen zwischen zehn und zwanzig Jahren betroffen.
Neue Freie Presse am 2. Mai 1924
Das rapide Umsichgreifen der Encephalitis lethargia in England erregt im Lande größte Beunruhigung. Die Seuche erfaßt Personen jeden Alters. In der Hauptsache aber sind junge Menschen zwischen zehn und zwanzig Jahren betroffen.
Wie berichtet, sind in den ersten Wochen April 649 neue Fälle beobachtet worden. Das erhebt die Zahl der in diesem Jahre Erkrankten auf 1409, fast dreimal so viel als im Jahre 1922. Der Prozentsatz der Todesfälle ist leider sehr hoch. Er bewegt sich zwischen 25 und 50 Prozent. Von den in den ersten drei Wochen des Monates April erkrankten 649 Personen befürchtet man bei mäßiger Schätzung 160 Todesfälle, die doppelte Zahl dürfte auf lange Jahre oder gar für ihr Leben dauernden Schaden an Geist und Körper erleiden und nur ein Viertel der Opfer der Wiederherstellung zugeführt werden können.
Das Varieté auf dem Ozean
Auf hoher See kann es äußert langweilig werden. Das soll sich jetzt ändern.
Neue Freie Presse am 1. Mai 1914
Die modernen Ozeanriesen, die den Verkehr zwischen den deutschen, französischen oder englischen Häfen und Newyork vermitteln, haben längst das Außerordentlichste ersonnen, um die sechs- bis achttägige Reise angenehm, abwechslungsreich und amüsant zu gestalten. Schwimmbäder, Schiffsorchester, Feste unter Mitwirkung der Passagiere, unter denen es ja nie an großen Künstlern fehlt, fürstlich eingerichtete Salons, Spielzimmer und vor allem die Diners und Soupers mit ihren zehn und mehr Gängen sorgen dafür, daß die Fahrt recht rasch vergeht.
Und doch gibt es inmitten all dieses Luxus Stunden voll tödlicher Langweile.
Stunden, in denen man an nichts denkt als an die Meilenzahl, die man noch zurückzulegen hat, und besonders für die, die gewöhnt find, spät schlafen zu gehen, kann der Abend auf hoher See, wenn das Wetter den Aufenthalt auf Deck nicht erlaubt, alles eher als kurzweilig werden.
Nun geht die Cunardlinie daran, mich dem abzuhelfen. Ihr neuer Riesendampfer „Aquitania“, der am 29. Mai seine Jungfernreise vom Liverpool nach Newyork antritt, wird, wie die Londoner Blätter erzählen, ein vollständiges Varieté mit nehmen. Im Hauptsalon ist eine reguläre Bühne errichtet worden und eine halbe Stunde nach dem Souper wird dort eine Varietévorstellung beginnen, der auf bequemen Klubfauteuils 800 bis 1000 Personen bis Mitternacht beiwohnen können. Die Gesellschaft ist schon zusammengestellt: Frank Allen ist ihr Direktor, und sie enthält weltberühmte Artisten, wie George Robey, Barclay Gammon, die „Tiller-Girls“ usw.