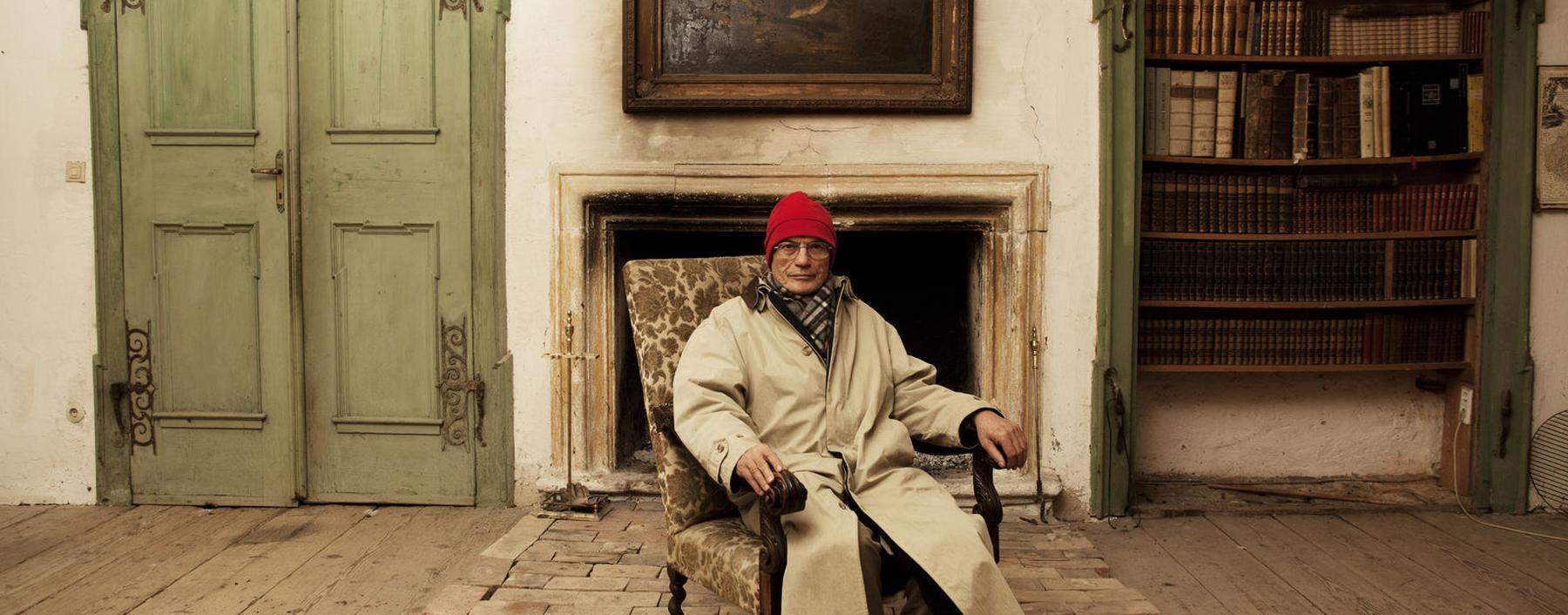Ist es die Pflicht des Kindes, das Gute am Vater zu finden – auch wenn dieser ein Kriegsverbrecher war? Dieser Meinung ist zumindest Horst Wächter, Sohn Otto Wächters, der selbst weder Antisemit noch Holocaust-Leugner ist. Auf den Spuren von Nazi-Vätern und ihren Nachkommen.
Anfang Jänner trat ein Mann, der in dem kleinen österreichischen Ort Thal geboren wurde, in einem achtminütigen Video auf und gab eine eindringliche Stellungnahme zum Sturm auf das US-Kapitol ab. Eines führt zum anderen, warnte er und unterstrich, dass er aus Erfahrung sprach: „Ich bin in Österreich aufgewachsen.“ Arnold Schwarzeneggers Verteidigung der Demokratie und ihrer Institutionen, unterstützt von seinem Schwert aus „Conan, der Barbar“ und dazugehöriger Filmmusik, zog Parallelen mit den Ereignissen der Novemberpogrome 1938, der sogenannten Reichskristallnacht, als der Pöbel im ganzen Deutschen Reich von Berlin bis Wien Juden angriff. Das Video wurde Millionen Mal weltweit gesehen, aber mehrere meiner österreichischen Bekannten bemerkten, dass es in ihrem Land weniger Verbreitung fand als in anderen.
Schwarzenegger gab eine persönliche Stellungnahme ab und erinnerte an seine Jugend in Gegenwart „gebrochener Männer, die ihre Schuld an der Beteiligung am schrecklichsten Regime der Geschichte wegtranken“. Es seien einfache Leute gewesen, die „einfach mitgelaufen sind“, sagte er, keineswegs rabiate Antisemiten oder Nazis. „Ich habe mich dazu nie öffentlich geäußert, denn es ist eine schmerzhafte Erinnerung“, setzte er fort und stellte uns seinen eigenen Vater vor – einen gewalttätigen Trinker wie so viele in der Nachbarschaft.
Wie erklärte sich Schwarzenegger ein derartiges Benehmen? Die Schmerzen der Kriegswunden oder vielleicht, „was sie sahen oder taten“. Was sie taten – diese Worte deuten auf dunkle Ereignisse. Schwarzenegger hätte sagen können, dass er von diesen Dingen wusste, weil sein Vater NSDAP-Mitglied gewesen war. Ich kritisiere ihn nicht, dass er diese Tatsache nicht enthüllte, obwohl das sorgfältige Abwägen seiner Worte bedeutete, dass viele Zuseher seine persönliche Abrechnung nicht verstehen konnten. Solches Schweigen, das oft die Dienerin jener „Lügen und Lügen und Lügen“ ist, von denen Schwarzenegger sprach, ist in den letzten Jahren mit einiger Häufigkeit in mein Leben eingedrungen. Die Vergangenheit wird in Österreich, so scheint es, nie wirklich akzeptiert, selbst wenn einzelne Aspekte mit Vorsicht angesprochen werden.
Zu Weihnachten 2020 erhielt ich eine E-Mail aus Wien. Die Absenderin stellte sich als Marie-Theres Arnbom vor, Historikerin und Urenkelin von Robert Winterstein, neben dessen Haus in Pötzleinsdorf, einem Außenbezirk von Wien, sie lebt. Winterstein war ein angesehener Jurist und bis März 1938 Generalprokurator, der nach der Machtübernahme der Nazis und der Eingliederung Österreichs in das Dritte Reich am 13. März festgenommen wurde, danach per Schreiben vom 14. September aus dem Staatsdienst entlassen wurde, seine Pension verlor und nach Buchenwald deportiert wurde, von wo er nicht mehr zurückkehrte. Seine Familie bewahrte in Erinnerung an ihn jenen mit Schreibmaschine geschriebenen Brief vom 14. September 1938, der mit einer selbstbewussten, jedoch unentzifferbaren Unterschrift endete.
Achtzig Jahre später wurde das Rätsel gelöst, wie Arnbom schrieb, dank meines Buchs „Die Rattenlinie“. Das Buch war kurz zuvor auf Deutsch erschienen, sie hatte es als Weihnachtsgeschenk bekommen. Es erwähnt ihren Urgroßvater, einen der mindestens 16.200 österreichischen Beamten, die ihre Stellung verloren, weil sie als Juden oder politisch unzuverlässig galten. Die sogenannte Säuberungsaktion wurde von der zentralen Figur des Buchs durchgeführt, Otto Wächter, ein österreichischer Anwalt, Nazi und Mitglied der SS. Er floh nach dem gescheiterten Juli-Putsch 1934 gegen die Regierung von Bundeskanzler Engelbert Dollfuss von Wien nach Berlin, um vier Jahre später im Triumph zurückzukehren und Staatssekretär zu werden. Es war seine Unterschrift, wie ich in meinem Buch bestätigte, die das unglückselige Familienerbstück zierte.
Die Entschlüsselung der komplizierten Unterschrift war jedoch nicht der Grund für Arnboms Schreiben. Bemerkenswerterweise erwähnte sie, dass Otto Wächter der Großvater ihrer langjährigen Nachbarin und Freundin war. Vor einem Jahr hatten sie und die Wächter-Enkelin einen Vortrag von mir in einem Wiener Theater besucht, ohne von den in dem Brief enthaltenen verborgenen Familienverbindungen zu wissen. „Was für eine seltsame Situation“, sinnierte Arnbom – Wächters Sohn, der ebenfalls Otto hieß, hatte als Diakon bei ihrer Hochzeit amtiert. „Man kennt eine Familie so lange, ist miteinander befreundet, und auf einmal taucht eine andere Verbindung auf, die eine weitere Beziehung mit sich bringt.“