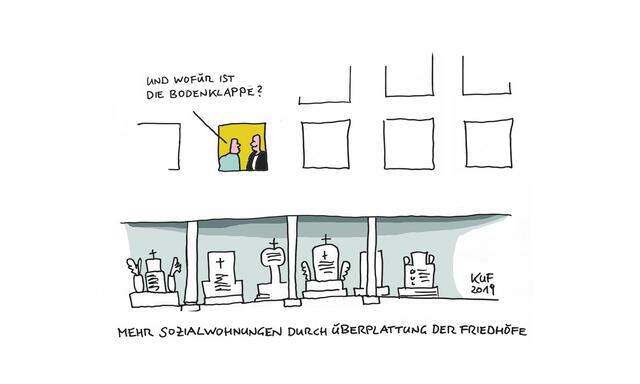Die politische Polarisierung vergiftet den Diskurs. Die Politik scheint immer weniger fähig, Probleme im Konsens zu lösen.
Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Die Angst vor einer Rezession hat Europa erfasst und greift weltweit um sich. Der Rückzug Großbritanniens aus der EU scheint nun unmittelbar bevorzustehen, und Italien versucht gerade, sich nach einer neuerlichen Regierungskrise wieder hochzurappeln. Der Argentinische Peso bricht zusammen, weil erwartet wird, dass die Regierung von Präsident Mauricio Macri bald von einer weiteren peronistischen Regierung abgelöst wird. Der Bombenanschlag auf eine Hochzeit in Afghanistan kündigt die erneute Eskalation der Gewalt an. Und die Angst vor einer blutigen Niederschlagung der prodemokratischen Demonstrationen in Hongkong wie vor 30 Jahren auf dem Tian'anmen-Platz wächst.
Unterdessen werden die USA von Naturkatastrophen heimgesucht, mussten widerwärtige Enthüllungen über einen vermögenden notorischen Pädophilen mit Verbindungen zu den Reichen, Berühmten und Mächtigen verkraften und mehrere schreckliche Massaker erleben. Jeder dieser Vorfälle verdient eine sorgfältige Analyse. Doch in einer rund um die Uhr, sieben Tage die Woche eintreffenden Nachrichtenflut, die durch ungefilterte Social-Media-Beiträge verstärkt wird, wurden die unmittelbaren Reaktionen von gegenseitigen parteipolitischen Schuldzuweisungen dominiert.
Ein Diskurs der Vernichtung
In der Vergangenheit betrachteten Amerikaner diejenigen, die anderer Meinung waren als sie selbst, als verbohrt, unempfänglich, individuellen wirtschaftlichen Interessen verpflichtet oder von unterschiedlichen Werten oder kulturellen Erfahrungen motiviert. Aber heute hat der Impuls, Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken zu erregen, einen von übler Verleumdung und einer Taktik der verbrannten Erde geprägten Diskurs hervorgebracht, der darauf abzielt, den Gegner zu vernichten. Wir brauchen dringend eine breit angelegte Bewegung, um uns gegen diese Art von politischem Diskurs zur Wehr zu setzen.
Die amerikanische Geschichte ist voll von Beispielen für Menschen, die zusammengearbeitet haben, um schwerwiegende Probleme zu lösen oder zumindest zu entschärfen – oft großen Widrigkeiten zum Trotz und mit erheblichem Risiko. Doch das allmähliche Verschwinden eines auf Fakten basierenden Geschichtsunterrichts in den Schulen scheint vielen Amerikanern die gemeinsame Basis und den Optimismus geraubt zu haben, die notwendig sind, um Herausforderungen so wie früher zu meistern.
Nehmen wir die Beziehungen zwischen den Ethnien als Beispiel. Die meisten Amerikaner dürften mit den wichtigsten historischen Meilensteinen vertraut sein. 1863 unterzeichnete Präsident Abraham Lincoln die Emanzipationsproklamation. 1954 fällte der Oberste Gerichtshof seine Entscheidung im Fall Brown v. Board of Education, mit der die Rassentrennung an den Schulen beendet wurde. Im folgenden Jahrzehnt nahm die Bürgerrechtsbewegung unter der Führung von Martin Luther King Jr. Fahrt auf. 1965 unterzeichnete Präsident Lyndon Johnson den Voting Rights Act,der die volle politische Teilhabe von Minderheiten, besonders Afroamerikanern, gewährleisten sollte, dem 1968 der Fair Housing Actfolgte, der Diskriminierung in Zusammenhang mit Wohnraum hinsichtlich Ethnie, Hautfarbe, Religion, oder Nationalität verbietet.
Während Woodrow Wilson, ein vermeintlich progressiver demokratischer Präsident, sich weigerte, ein Gesetz gegen Lynchjustiz zu unterstützen, befürwortete der republikanische Calvin Coolidge (1923–1929) nicht nur das Gesetz gegen Lynchjustiz, sondern nahm sogar an den Demonstrationen zur Unterstützung des Gesetzes teil. Er förderte auch eine medizinische Fakultät für Afroamerikaner.
Der Blick auf das Gute
Präsident Richard Nixon seinerseits hat die Aufhebung der Rassentrennung maßgeblich vorangetrieben. Nixon organisierte rassenübergreifende Gremien in den Südstaaten, um dafür zu sorgen, dass das Brown-Urteil respektiert wird. Daniel Patrick Moynihan zufolge, einem demokratischen Senator aus New York, war Nixons Durchsetzung der Desegregation seine größte innenpolitische Leistung. Innerhalb von nur sechs Jahren sank der Anteil afroamerikanischer Schüler, die rein schwarze Schulen im Süden des Landes besuchten, von 68 auf acht Prozent.
Das Gute in mit Makeln behafteten Persönlichkeiten wie Lyndon B. Johnson und Nixon zu sehen, kann uns helfen, die Perspektive wiederzuentdecken, auf der produktive Zusammenarbeit basiert. Aber wir müssen auch wieder ein Gespür dafür bekommen, unserem Land einen Dienst zu erweisen. In habe erlebt, wie US-Präsidenten bittere Niederlagen einstecken mussten, weil sie die Interessen des Landes über ihre eigenen gestellt hatten.
Bruch von Wahlversprechen
Ronald Reagan etwa unterstützte die Bemühungen von US-Notenbankchef Paul Volcker, die zweistellige Inflation einzudämmen, und wusste sehr wohl, dass die daraus resultierende Rezession die Republikaner bei den Zwischenwahlen 1982 teuer zu stehen kommen würde.
Ebenso akzeptierte Präsident George H.W. Bush kurzfristige politische Risken, um langfristig Gutes zu tun. Um die Krise der Savings-and-Loan-Sparkassen in den USA und Schuldenkrisen in den Entwicklungsländern in den Griff zu bekommen, die Ölpreiskrise des Ersten Golfkriegs zu bewältigen und einen Haushaltskompromiss zur Eindämmung der Ausgaben zu schmieden, musste er sein Versprechen brechen, „keine neuen Steuern“ zu erheben.
Manchmal tauchen Helden an überraschenden Orten auf. Eine solche Figur war Lane Kirkland, der verstorbene Präsident des AFL-CIO, Amerikas größter Gewerkschaftsorganisation. Kurz nach dem Fall der Berliner Mauer war ich mit einer Delegation des Präsidenten in Polen, um den Übergang des Landes zur Marktwirtschaft zu unterstützen. Dort erfuhr ich und bekam es von Lech Wałęsa, dem legendären Arbeiterführer bestätigt, dass Kirkland die Bewegung Solidarność gegen den Kommunismus entscheidend unterstützt hatte. Am heftigen Widerstand der Linken in seiner Gewerkschaft vorbei hatte Kirkland geholfen, Faxgeräte nach Polen zu schmuggeln. Ich rief Kirkland an und sagte: „Wir mögen unsere Meinungsverschiedenheiten in der Wirtschaftspolitik haben, aber ich danke dir für das, was du für die Polen getan hast.“
Bemerkenswerte Fortschritte
Wenn Sie das nächste Mal von einer niederträchtigen Tat erfahren, die von jemandem begangen wurde, den Sie als Gegner betrachten, besinnen Sie sich einen Moment darauf, dass die meisten von uns ebenso gute – sogar heroische – Taten vollbringen können. Die Menschheit ist bei Weitem nicht perfekt. Aber wir haben es geschafft, durch Zusammenarbeit bemerkenswerte Fortschritte zu erzielen. Die lautesten Stimmen im Internet und anderswo dürfen diese Botschaft nicht übertönen.
Aus dem Englischen von Sandra Pontow. Copyright: Project Syndicate, 2019.
E-Mails an: debatte@diepresse.com
Der Autor:
Michael J. Boskin
(*1945 in New York) studierte Wirtschaftswissenschaften in Berkeley. Derzeit ist er Professor für Ökonomie an der Universität Stanford und Senior Fellow der Hoover Institution. Von 1989 bis 1993 war er Chef des wirtschaftlichen Beraterstabs des damaligen amerikanischen Präsidenten, George Bush senior. [ Project Syndicate]
("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2019)