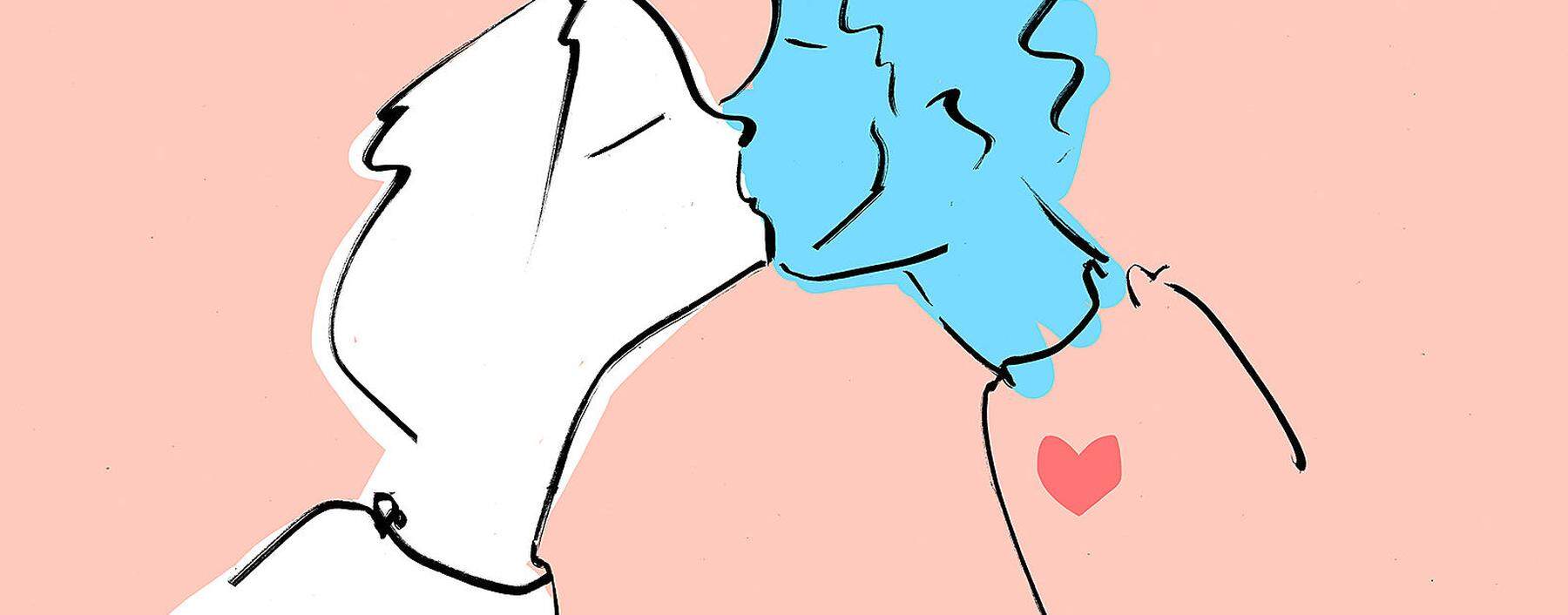Die Bindungstheorie hat es auch bis in die sozialen Medien geschafft. Doch lassen sich Menschen wirklich so leicht in bindungsfähige und jene, die es nicht sind, unterteilen?
Einmal mit einem missplatzierten Like oder einem unbedachten Hashtag falsch abgebogen und schon wird TikTok zu einem großen Marktplatz der Hobbypsychologen und -therapeutinnen. Fleißig werden Diagnosen feilgeboten, von Borderline und Burnout (Selbstdiagnose) bis Narzissmus und Bindungsangst (Fremddiagnose). Die Symptomatik wird oft anhand kurzer Rollenspiele erklärt - die humorvolle Pointe bleibt selten aus - und mit passendem Soundtrack und Choreografie hinterlegt.
Hoch im Kurs der therapieverwandten Themen, steht auch die Bindungstheorie (#attachmenttheory). In diversen Videos wird erklärt, wie es ist, eine Person mit sicherem Bindungsverhalten zu daten, welche Gedanken auf einen vermeidenden Bindungstyp hinweisen und welche auf einen unsicher-ambivalenten. Vier Kategorien gibt es: den sicheren, unsicher-vermeidenden, unsicher-ambivalenten und desorganisierten Bindungstyp. Bei so klar vereinfachenden Kategorien wird man zu Recht schnell stutzig. Lassen sich Menschen so grob in Typen einteilen?