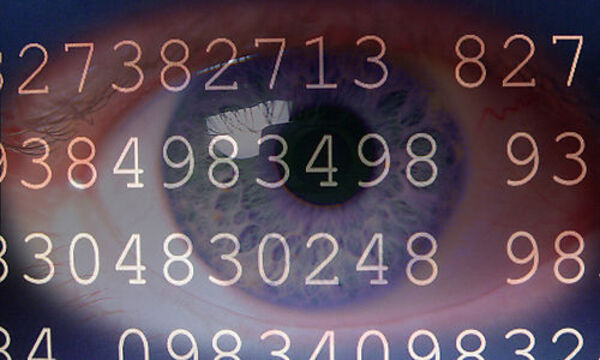SERIEDurch die Vorratsdatenspeicherung entstehen den Providern hohe Mehrkosten. Die EU verpflichtet Staaten nicht zur Entschädigung.
Die Vorratsdatenspeicherung ist teuer. Der Europäische Datenschutzbeauftragte schätzte die Mehrkosten für betroffene Unternehmen bereits 2005 auf bis zu 150 Millionen Euro pro Jahr. Auch der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ging damals von enormen Belastungen für die Telekommunikationsindustrie aus. In Österreich wurden die Kosten vergangenes Jahr auf insgesamt 15 Millionen Euro geschätzt.
Teuer wird vor allem die Anpassung und Aufrüstung der Technik, die Anpassung der betrieblichen Abläufe zur sicheren Archivierung der Daten und schließlich die Bearbeitung von Behördenanfragen. Bisher mussten in Österreich lediglich jene Daten gespeichert werden, die zur Abrechnung notwendig waren. Sobald die Daten für die aktuelle Rechnungsperiode nicht mehr verfügbar sein müssen, gebietet das bisherige Telekommunikationsgesetz die Löschung.
Bund trägt nicht die gesamten Kosten
Die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verpflichtet Staaten nicht zur Entschädigung betroffener Unternehmen. In Österreich wurden die Kosten im Februar 2011 mit 15 Millionen Euro beziffert. 20 Prozent davon, also drei Millionen Euro, sollen von den Unternehmen selbst getragen werden, den Rest übernimmt der Bund. Der Löwenanteil davon (63 Prozent) wird vom Infrastrukturministerium berappt, das Innenministerium zahlt 34 Prozent, das Justizressort einen Fixbetrag von 360.000 Euro, was drei Prozent entsprechen soll.
Kritik: Strafverfolgung ist staatliche Aufgabe
SERIE VORRATSDATENSPEICHERUNG
Der Dachverband österreichischen Internet-Provider, die ISPA, hält das für ungerecht. Die Provider fordern, dass der Staat die gesamten Kosten trägt. Schließlich sei die Vorratsdatenspeicherung ein öffentliches Interesse, weil sie der Strafverfolgung dient, die eine staatliche Aufgabe ist. Ab 1. April 2012 müssen Internet-, Telefon- und Mobilfunkbetreiber alle Verkehrsdaten ihrer Kunden anlasslos sechs Monate lang speichern. DiePresse.com informiert bis dahin mit einer Serie über die umstrittene Vorratsdatenspeicherung und ihre Auswirkungen.
(sg)