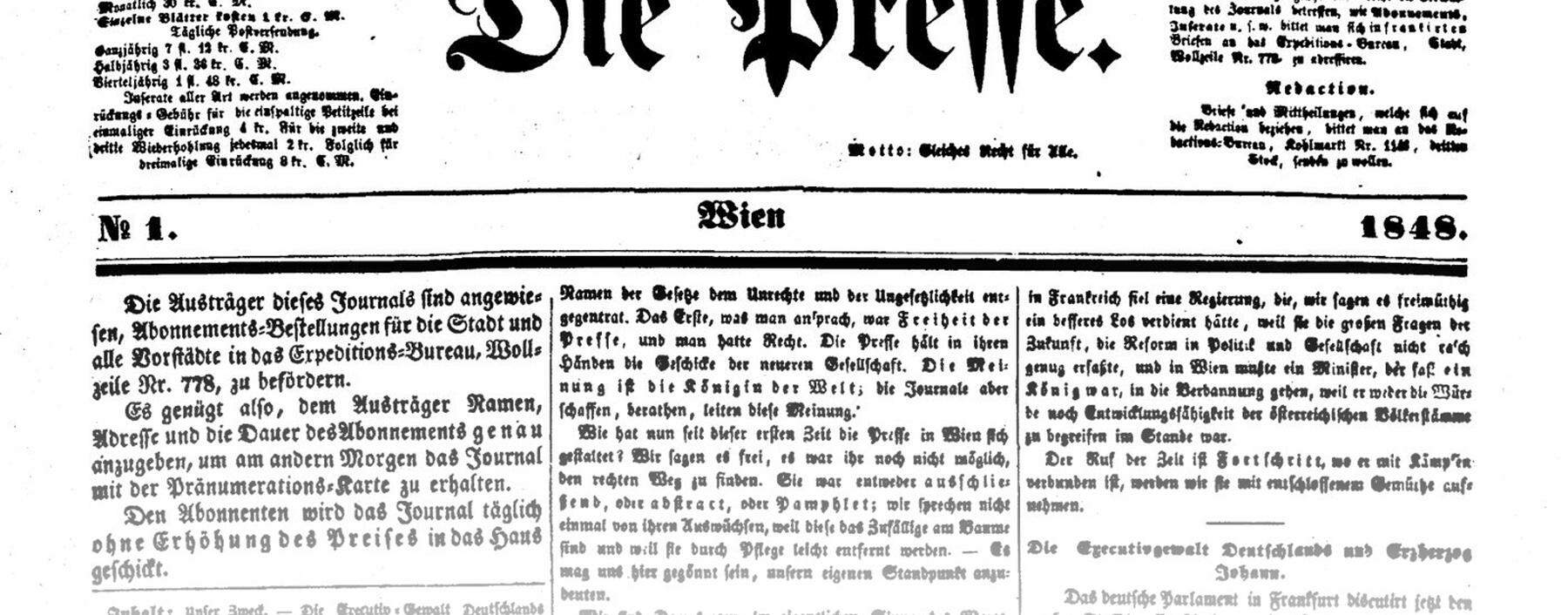Drei “Riesenbomben” auf einem Spielfeld haben Unheil gebracht.
Neue Freie Presse am 16. Mai 1924
Ueber das folgenschwere Explosionsunglück in Ottakring liegt nunmehr nachstehende detaillierte Schilderung des Herganges vor:
Die Produktion war für 8 Uhr abends angesagt und bis auf das letzte Plätzchen ausverkauft. Der Raum für die Vorstellung war in dem oberen Teil des Sportplatzes dein Spielplatz der Fußballreservemannschaften gelegen und reichte von dem einen Goal, das an die Ziegelmauer der Garteneinfriedung des Schottenhofes grenzt, bis zum gegenüberliegenden Goal – eine Entfernung von etwa 200 Schritten. Bei der Ziegelmauereinfriedung waren die Feuerwerksfronten unmittelbar nach der Einfriedung errichtet und einige Schritte vor ihnen waren noch zwei mächtige Holzmaste für weitere Feuerwerkskörper hergerichtet, die nach deren Abbrennen umgelegt werden konnten, um die Aussicht auf die dahinterliegenden Feuerwerksfronten freizugeben.
Von den Fronten, bei denen sich der Pyrotechniker und seine Gehilfinnen aufhielten, lag ein freier Platz, an dem sich dann in der Breite des Spielplatzes in den langen Reihen die hintereinander aufgestellten Holzsitze für die Zuschauer befanden. Außer diesen zahlenden Besuchern hatte sich eine große Zahl, besonders von Jugendlichem ohne Eintrittskarten an den Zäunen, vor der Einfriedungsmauer und in den umliegenden Gärten angesammelt. Bei klarem Himmel nahm die Veranstaltung einen äußerst günstigen Verlauf, bis sich plötzlich das Unglück ereignete, das ein Menschenleben gekostet und mehrere andere Zuschauer gefährdet hatte.
Es war bereits gegen ¾ 10 Uhr nachts – für 10 Uhr war das Ende des Feuerwerks angesetzt – als, wie es auf dem Programm hieß, „fünf Riesenbomben“ abgebrannt werden sollten. Zu diesem Zwecke hatte der Pyrotechniker Zack fünf selbst angefertigte gußeiserne Mörser von beträchtlicher Länge in die Erde eingegraben, die am oberen Ende etwas aus der Erde ragten und die in ihrem Inneren mit Leuchtkörpern ausgestattet waren, die durch eine Triebmaschine emporgeschleudert werden sollten. Heinrich Zack bediente selbst diese Mörser, während seine Gehilfinnen nur beim Entzünden der kleinen Feuerwerkskörper behilflich waren. Er näherte sich nun der ersten „Riesenbombe“ und brachte sie zum Entzünden, Während er gleich nachher rücklings gegen die Gartenmauer ging, erfolgte eine Detonation und die Sache schien ordnungsgemäß zu verlaufen.
Nach zirka einer Minute Intervall näherte sich zack der zweiten Bombe und brachte auch sie zur Entzündung, um sich dann gleich wieder zurückzuziehen, ohne auf die Bombe zu blicken. Bei dieser Explosion ging es nun wie ein Ruck durch die Zuschauer, ohne daß man wußte, was geschehen sei, und man hörte vielfach die staunenden Ausrufe: „Was ist denn da los?“ Es entstand aber keine besondere Unruhe. He nun zack die dritte Bombe entzünden konnte, was nach einem neuerlichen Zwischenraum von einer Minute hätte geschehen sollen, erschollen von der dem Standorte der Bomben in den gegenüberliegenden Goals, wo die Stehplätze von den Zuschauern eingenommen worden waren, Rufe: „Wache! Wache!“
Während das Publikum nun glaubte, es sei dort zu einer Rauferei gekommen und auch Mahnungen laut wurden, doch Ruhe zu geben, eilte Wache herbei und fand dort eine Frau mit einer fürchterlichen Verletzung und blutüberströmt am Boden liegend vor. In der Hand hielt sie ihren Hut und hatte am Arm die Handtasche übergehängt. Neben ihr stand ein Mann, der an der rechten Hand erheblich blutete und der, wie sich herausstellte, der Gatte der Unglücklichen war. Die Frau war Grete Wimmer, am Vogelweidplatz wohnhaft, eine Bankbeamtensgattin, die auf der Stelle tot geblieben war. Niemand konnte im ersten Augenblicke angeben, wie sich das Unglück eigentlich zugetragen hatte, doch fand man bald darauf einen scharfsinnigen, etwa einen Quadratmeter großen unregelmäßigen Bestandteil eines der eingegrabenen Riesenbomben, der bei der Explosion in die Luft geflogen war. Das Sprengstück war, fast senkrecht aus der Luft kommend, auf das unbedeckte Haupt der Unglücklichen herabgesaust und hatte ihr buchstäblich den Kopf der Breite nach durchgeschlagen. Das gleiche Sprengstück hatte auch noch den Gatten der unglücklichen Frau Wimmer, der daneben stand, an der rechten Hand getroffen und erheblich verletzt.
Heute vor 100 Jahren: Das neue Finnland
Wenn eine Wahl auf den ersten Blick so gar nichts ändert.
Neue Freie Presse am 15. Mai 1924
Was auch die moderne Demokratie sein mag: Ein immer wieder erneutes Wählen gehört jedenfalls zu ihr.
In Finnland ist am 1. und 2. April auf Grund des seit 1907 normierten allgemeinen und gleichen Stimmrechtes für Männer und Frauen und des Verhältniswahlrechts eine neue Kammer („Reichstag“) gewählt worden. Diese Wahlen hätten eigentlich erst im Sommer 1925 stattfinden sollen, doch war im Januar vom Präsidenten der Republik die im Juli 1922 gewählte Kammer aufgelöst worden, weil die sozialdemokratische Partei, die dank der Unterstützung nicht nur der industriellen, sondern auch der ländlichen Arbeiterschaft in Finnland ein einflußreicher politischer Machtfaktor ist, diese Maßnahme mit großem Nachdruck und sogar unter der Drohung des Ausbleibens aus der nächsten Kammersitzung verlangt hatte.
Die Volksvertretung war nämlich dadurch dezimiert worden, daß die Fraktion der Kommunisten durch ein gegen ihre Mitglieder eingeleitetes gerichtliches Verfahren wegen Landesverrates in Untersuchungshaft geraten war. Auf bürgerlicher Seite wollte man erst das Ergebnis des Prozesses abwarten, ein Standpunkt, der auch von der linksstehenden bürgerlichen Regierung vertreten wurde und zu ihrer Demission wie zur Bildung des gegenwärtigen Beamtenkabinetts als eines provisorischen Expeditionsministeriums führte.
Der Wahlkampf wurde, wie gewöhnlich in Finnland, von keiner besonderen politischen Frage, sondern hauptsächlich von den allgemeinen Gegensätzen der Parteien beherrscht. Es bekämpften sich somit: unter den linksstehenden Gruppen die parlamentarischen Sozialisten, die in der Partei der Sozialdemokraten vereint sind, und die offen revolutionären Kommunisten, die hier den russischen Bolschewismus repräsentieren. Unter den Bürgerlichen standen sich die rechts-gerichteten, deren finnischsprechender Teil von der sogenannten Sammlungspartei vertreten wird, und die links-gerichteten gegenüber, die auch das bürgerliche Zentrum genannt werden und aus der „Fortschrittspartei“ und der Partei der Kleinbauern bestehen. Dazu kam, wie immer, die schwedische Partei, in der sich das schwedisch-sprechende Neuntel der Bevölkerung Finnlands politisch zusammengeschlossen hat.
Es hängt mit dem zähen, sachlichen, wenig aufwallenden Volkscharakter zusammen, daß Neuwahlen in Finnland in der Vertretung der verschiedenen Parteien nur unbedeutende Verschiebungen hervorzubringen pflegen. Das war auch jetzt der Fall.
Anmerkung: Die elfte Wahl zum finnischen Parlament fand Anfang April 1924 statt, nachdem die 27 Abgeordnete der Sozialistischen Arbeiterpartei im August 1923 wegen angeblichen Landesverrats verhaftet wurden und Präsident Kaarlo Juho Ståhlberg die Auflösung des Parlaments verordnet hatte. Das Sozialistische Arbeiter- und Kleinbauernwahlbündnis trat für die Sozialistische Arbeiterpartei bei der Wahl an, verlor jedoch neun Sitze. Davon profitierten in die Sozialdemokraten, die vor dem Landbund, der nur leicht verlor, klar die stärkste Kraft blieben. Erstmals seit drei Jahren entstand in der Folge eine Mehrheitsregierung.
Wie steht es heuer um die Minne von Meister Lampe?
Über Jagdansichten in Österreich-Ungarn.
Neue Freie Presse am 14. Mai 1924
Ein Jäger schreibt uns: Der Wonnemonat Mai hat sich in Oesterreichs Landen gar nicht gut eingeführt, ja die Fostperiode gleich zu Beginn des Monats verursachte der Landwirtschaft, noch mehr aber dem Weinbauern großen Schaden. Obst- und Weinbau erlitten in einer Zeit, wo die schönsten Hoffnungen vorhanden waren, schwere Schäden, die kaum mehr zu heilen sind. Ein paar Stunden Tieftemperaturen, ein Eishauch, der über die Landen strich, bereiteten der Landwirtschaft für ein ganzes Jahr enorme Verluste. Gleich wie der Landwirt hat auch der Jäger gar sehr mit Wettergunst und -ungunst zu rechnen: auch er bangt und sorgt das ganze Jahr für seinen Wildstand, den der nächste Wettersturz, die heraufziehende Hagelwolke, eine Regenperiode oder Dürre zu vernichten vermag.
Bis jetzt hatte sich das Frühjahr noch gnädig gezeigt für den Wildstand, namentlich für das Niederwild. Junghasen gab es wohl schon von Mitte Februar ab in sehr geschützten Lagen: man fand sie in den Düngerhaufen der Feldfluren, wo sie vor dem harten Winter weiter am besten geschützt waren. Die meisten Junghasensätze brachte jedoch der Monat März: die sogenannten „März-Hasen“. Sie sind es, mit denen der Jäger als Zuwachs vor allem rechnet. Tritt durch mildes Wetter verführt, Meister Lampe gar zu früh in die Minne, so daß die ersten Hasensätze noch im Machtbereiche des Winters ihr kurzes Erdendasein beginnen, so ist die Einbuße schon von vornherein eine große, wird aber eine katastrophale, sobald auch im vorgeschrittenen Frühjahre Wetterstürze eintreten, die die letzten Reste des ersten Satzes und den in die Welt gesetzten zweiten Saß mitvernichten.
Der strenge Winter aber, in den Niederwildrevieren wohl nicht von zu reichlichen Schneemengen begleitet, ließ Meister Lampe nicht recht zu vorzeitiger Minne kommen: dies rettete Tausenden von Junghasen das winzige Leben auf den Flüren Nieder- und Oberösterreichs, Mährens, Böhmens und Ungarns. Auch die Südsteiermark und Galizien haben einige gute Hasenjagdgebiete, in welchen heuer die junge Deszendenz ganz prächtig nachwächst. Im Tullner Boden und im Marchfelde erwartet man heuer ein sehr befriedigendes Hasenjahr. Aehnliches ist vom Feldhuhne und dem Fasan zu sagen. Das Rebhuhn befindet sich augenblicklich in der Lege- und Brutperiode, desgleichen der Fasan.
Während sonst nach Winterausgang manche Fasanerkrankungen und in der Folge auch epidemische Erkrankungen gemeldet wurden, ist bislang noch nichts bekannt. Der Jungfasan, der in nicht gar langer Zeit die Fasanerien bevölkern wird, kann dahingerafft werden, sobald er ins Leben getreten ist und erliegt gar leicht mancherlei Krankheiten. Dagegen sind die Rebhühner schon gefährdet kurz nach dem Paaren.
Die letzte Blaue
Der 1. Juni wird unter Umständen im Kalender eines jeden Straßenbahninteressenten rot angestrichen werden.
Neue Freie Presse am 13. Mai 1924
Damit wäre weniger eine parteipolitische Huldigung für die gegenwärtigen Machthaber im Rathaus beabsichtigt, als vielmehr dem inneren Drang Ausdruck verliehen, den Tag anzumerken, von dem angefangen auch die Straßenbahner sich endlich davon überzeugen ließen, daß der Weltkrieg, genau genommen, doch zu Ende gegangen sei. Die „letzte Blaue“ soll eine Stunde später verkehren, ganz so wie im tiefsten Wiener Frieden.
Man soll wirklich nicht mehr dazu verurteilt sein, im Theater oder im Konzertsaal zum eigenen Mißvergnügen und zu dem der übrigen Besucher vor Schluß wegzueilen, in der Garderobe Carpentier nachzuahmen, damit man doch vielleicht die Eventualität vermeide, bei Wind und Wetter seine Wohnung in irgendeinem entfernten Stadteil zu Fuß aufsuchen zu müssen. Es winkt die verführerische Aussicht, an heißen Sommerabenden - vielleicht wird es auch heuer solche geben - in die Umgebung Wiens hinausfahren zu dürfen, ohne einige Atemzüge Wienerwaldluft mit einem stundenlangen Fußmarsch zu bezahlen. Aber nur nicht übermütig werden! Mit dem Triumphgeschrei lieber ein wenig zuwarten! Noch ist es nicht viel mehr als eine zittrige Hoffnung, als ein vielversprechendes: Es dürfte! Es könnte! Als ein freundlich zwinkerndes: Vielleicht!
Jawohl, wir werden aller Voraussicht nach in irgendeiner Zukunft wieder zu dem Rang einer x-beliebigen Provinzstadt emporklettern, in der die Straßenbahnen bis Mitternacht verkehren, hier und dort sogar darüber hinaus; aber es ist noch keineswegs ausgemacht, ob das tatsächlich bereits in vierzehn Tagen der Fall sein wird. Noch sind nicht alle Schwierigkeiten behoben; noch wird beraten und verhandelt. Noch ist es nicht gelungen, den Straßenbahnern mundgerecht zu machen, daß die von ihnen geheischte Mehrleistung nicht etwa Nichtstuern und Nachtschwärmern zugute kommen soll, sondern im Lebensinteresse der arbeitenden Gesamtbevölkerung gelegen ist.
Von der Rathausgewaltigen darf man jedoch voraussetzen, daß sie hier die Rücksicht auf billige Popularität und auf Wählergunst in den Hintergrund stellen werden. Sie müssen sich sagen, daß keine Parteiangelegenheit auf der Tagesordnung steht, daß man unter Umständen den Mut zu einer Entscheidung aufbringen muß, die von jenen, denen sie neue Arbeitslast aufbürdet, mit ärgerlichem Brummen aufgenommen wird. Weder der reaktivierte Hochstrahlbrunnen, noch die Blumenkörbe an den Leitungsmasten werden den Wiener Kommunalsteuerzahler davon überzeugen, daß Wien die bestverwaltete Stadt ist, solange schwächliche Liebdienerei nach unten für die Wiener Verkehrsbedürfnisse nichts übrig hat als Projekte und vage Besprechungen.
Fünfundzwanzigtausend Dollar für das Monster von Loch Ness
Der Direktor des New Yorker Zoologischen Gartens will das Monster lebend.
Neue Freie Presse am 12. Mai 1934
Eine nette Gelegenheit, zu einem schönen Stück Geld zu kommen. Schließlich sind fünfundzwanzigtausend Dollar nicht zu verachten. Sogar wenn man die Dollarentwertung in Betracht zieht. Und dieses Geld liegt auf der Straße. Nein, das ist wieder zu viel behauptet. Wohl aber liegt es im See von Loch Neß.
Der Direktor des New Yorker Zoologischen Gartens will durchaus die persönliche Bekanntschaft eines Seeungeheuers machen und verspricht demjenigen, der ihm seinen Herzenswunsch erfüllt, eine Geldprämie in der angegebenen Höhe. Freilich sind noch einige Nebenbedingungen zu erfüllen. Für ein totes Seeungeheuer gibt der Herr Direktor keinen Cent. Man muß es also lebend fangen und es gesund und wohlbehalten im New Yorker Zoologischen Garten abliefern. Wer sich also etwa einbildet, den Schillerschen “Kampf mit dem Drachen” aufzuführen und an ein gutausgestopftes Seeungeheuer nach Newyork zu schicken, der befindet sich auf dem Holzweg.
Er muß dem Monster anders beikommen, muß es in eine Falle locken oder ihm Salz auf den Schweif streuen oder eine sonstige erprobte Methode der Vogelfänger anwenden. Dann aber erwächst ihm die Pflicht, das Seeungeheuer bis zu seiner Ankunft entsprechend zu verpflegen, was umso schwieriger ist, weil über die Kost, die von Seeungeheuern bevorzugt wird, nichts Gewisses bekannt ist.
Bei dem genauem Studium der Bedingungen des Preisausschreibens kommt man darauf, daß auch ein gut erhaltenes, sich der besten Gesundheit erfreuendes Seeungeheuer dem Herrn Direktor nicht unter allen Umständen zufrieden stellt. Er verlangt, daß das Monster mindestens zwölf Meter in der Länge messe. Armer Monsterfänger. Jetzt hat er richtig ein Seeungeheuer drangekriegt, nimmt das Zentimetermaß zur Hand und bemerkt zu seinem Schrecken, daß es nur elf Meter neunundzwanzig Zentimeter mißt. Da bekommt er einen roten Kopf und wirft das Monster einfach wieder in den See.
Wer weiß übrigens, ob sich nicht die Hotelbesitzer von Loch Neß, die durch das Seeungeheuer zu reichen Leuten geworden sind, energisch zur Wehr setzen und im englischen Parlament eine Bill zur Annahme bringen werden: Loch Neß wird hiermit zum Naturschutzpark erklärt. Seeungeheuer darf man weder füttern noch reizen, und das Fangen von Monstern ist bei Geld- und Arreststrafe strengstens verboten.
Wie das Wetter, so die Wirtschaft?
In Österreich kann man derzeit alle möglichen Wetterspielarten beobachten.
Neue Freie Presse am 11. Mai 1924
In der Prognose vom Freitag, in der für gestern Regen vorausgesagt war, hieß es trostvoll: „Sonntag wahrscheinlich schon wieder Bewölkungsabnahme.“ Der Samstag hat leider redlich gehalten, was der Freitag versprochen hatte, und man konnte alle Spielarten des Regens studieren.
Bald tröpfelte aus trostlos gramen Gewölk eintönig der Schnürlregen, dann goß es in Strömen, als würden Riesenkübel auf die bedauernswerten Passanten herabgeschüttet. Wollte man aus dem platzregenartig senkrechten Wassersturz schon die Hoffnung auf baldige Aufheiterung ableiten, so warf eine Winddrehung diese Kombinationen über den Haufen und in schiefen Strichen spritze einem ein richtiger Landregen ins Gesicht. Hat die Wetterprognose für Samstag nur allzu recht behalten, so wünscht man sich um so mehr zur Entschädigung, daß ihre optimistische Schlußpointe, die dem Sonntag galt, ebenfalls in Erfüllung gehe.
Von einem Wetterfachmann wurde uns in später Nachtstunde mitgeteilt, daß die Aufheiterung aus Westeuropa mit Riesenschritten zu uns marschiere und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon in den Sonntag frühlingshelles Maiwetter verspreche. Den geplagten Wienern, die jetzt ohnedies schwer genug unter der Wirtschaftskrise seufzen, ist es wirklich zu gönnen, daß sich wenigstens das Wetter endlich ihrer erbarme.
Die Riesenkonditorei im Operntheater
Dies ist der Ort, an dem Naschfantasien wahr werden – trotz Wirtschaftskrise.
Neue Freie Presse am 10. Mai 1924
Die Naschkatzen beiderlei Geschlechts konnten heute in Süßigkeiten schwelgen. Die Riesenkonditorei, deren Warenvorrat an feinen Süßigkeiten und hausgemachten Mehlspeisen lebendig wird, ist nicht nur der Wunschtraum eines kleinen Firmlings, sondern die Likörweichseln, Ananastorten und Himbeerkuchen, die sich zwei Stunden lang auf der Bühne im Reigen ergehen, bedeuten manchem Leckermäulchen die Verkörperung naschhafter Phantasien.
Die Ausführung im Rahmen der Richard Strauß-Feier hat durchaus den Charakter einer Sensationspremiere. Trotzdem wirft die schwere Wirtschaftskrise, in der sich Wien gegenwärtig befindet, ihre Schatten auch auf dieses festliche Haus.
Man sieht in den Sitzreihen ab und zu einen freien Platz, ein Anblick, der bei einem Theaterereignis dieser Art einigermaßen ungewohnt wirkt. Auch ist von jenem beinahe aufdringlichen Toilettenluxus, wie er beispielsweise beim Théatre paré zu beobachten war, nichts zu merken. Man empfindet es beinahe als wohltuend, daß die gar zu grelle Pracht, die während des heurigen Faschings viel Widerspruch erweckt hat, gedämpft ist und Exzesse des Luxus vermieden sind.
Ist das Bild im Zuschauerraum nicht ganz so farbenprächtig, wie man es von anderen Sensationsveranstaltungen in Erinnerung hat, so bietet die Bühne einen Anblick von mächtiger Kostümbuntheit. In zarten Abtönungen vereinigt sich ein Spitzengeriesel mithauchfeinen Wolken von Tüll und Schleiern und einer phantastisch schillernden Vielfalt von Phantasiegewandungen zu einer schilldernden Farbensymphonie.
Reizend ist die „Likörweichsel“, deren Darstellerin in einem regenbogenbunten Kleide ans Spitzen und Seide, mit faustgroßen Weichseln verziert, eine Riesenweichsel als Kopfputz trägt. Auch die kandierten Früchte machen den Zuschauernden Mund wässern, Prinz Zucker sieht wie ein Riesenzuckerhut aus und trägt Bänder, die mit Würfelzuckerstücken verziert sind. Drollig sind die Zwetschkenkrampusse in ihren grau-schwarzen Kostümen, deren Gliedmaßen in regelmäßigen Abständen abgebunden sind, so daß sie jenen leckeren Figuren die man zum Nikolotage bei allen Zuckerbäckern sieht, wirklich täuschend gleichen.
Keine Spur von Nachkriegsmisere in London
Wer London besucht, wird von dem Eindruck des Luxus und des Reichtums überwältigt sein.
Neue Freie Presse am 9. Mai 1934
Aus London wird uns geschrieben: Wenn England seine Sorgen und Schwierigkeiten hat, so weiß es sie gut zu verbergen. Wer London in diesen Tagen der Season besucht, muß jedenfalls von dem Eindruck des Luxus und des Reichtums, der sich Tag wie Nacht strahlend entfaltet, überwältigt sein. Krieg und Nachkriegsmisere? Vergessen oder überwunden, ausgelöscht.
London hat wieder sein Nachtleben in jener Großartigkeit, deren es sich in der guten alten Zeit erfreute. Die warmen Maiabende tun das ihrige, die Stimmung der Sorglosigkeit und des leichten Geldausgebens zu begünstigen. Auf den vornehmen Straßen und in den Nobelrestaurants pulsiert das Leben der eleganten Welt - wie einst im Mai der Vorkriegsjahre.
Namentlich im Theaterviertel, wo das Publikum die längere Nachtmahlpause gern nützt. So kann man noch am Tag - denn bis 21 Uhr ist es noch licht - im Piccadilly und Strand Prozessionen von schönen Frauen in prachtvollen Abendtoiletten mit edelsteingeschmückten Tiaras und elegante Herren im Smoking oder Frack vom Theater in die Restaurants zurückgehen sehen. (...)
Geld ausgeben und zeigen, daß man es tut, Luxus- und Prachtentfaltung vor den Augen der Öffentlichkeit, um ein weithin sichtbares Beispiel zu geben - das ist die Devise, die den Charakter der diesjährigen Season in London bestimmt.
War Schillers Vater ein Alkoholiker?
Wenn im Nationalrat das Privatleben eines Schriftstellers besprochen wird.
Neue Freie Presse am 8. Mai 1924
Friedrich Schiller mußte gestern im Nationalrat als Eideshelfer für den Mutterschaftszwang herhalten. Die Frauen sollen auch fernerhin Gebärmaschinen bleiben und Kinder, deren Dasein auf einen brutalen Vergewaltigungsakt etwa zurückzuführen ist, Kinder ferner von Wahnsinnigen und von Syphilitikern müssen zur Welt kommen, weil der Vater Friedrich Schillers angeblich ein Alkoholiker gewesen sein soll.
„Ein Alkoholiker höchsten Grades“, meinte der Abgeordnete Jerzabek, der sonst genealogische Studien höchstens in jenen Fällen betreibt, wo es ihm darauf ankommt, einen sogenannten Judenstämmling schonungslos zu entlarven. Einer der Redner von der Gegenseite trat Herrn Jerzabek mit gebotener Vorsicht entgegen. Die Ehrenrettung Schillers Seniors hörte sich allerdings einigermaßen reserviert an. Es mag richtig sein, daß Schillers Vater viel getrunken hat, meine dieser Grosso-Verteidiger, aber es geht demnach nicht an, ihn geradezu als Trunkenbold hinzustellen.
Begütigend fügte der Redner hinzu, Vater Schiller sei alles in allem genommen, ein Mann von ungewöhnlich hohen Fähigkeiten gewesen. So ist denn der wackere Leutnant, Feldscher und Werbeoffizier Kaspar Schiller im österreichischen Nationalrat mit einem blauen Auge davon gekommen. Eigentlich ist es aber gar nicht schön von dem christlichsozialen Abgeordneten Jerzabek, sich mit solcher Rücksichtslosigkeit in das Privatleben des alten Herren einzumischen.
Vater Schiller war ein ungemein frommer und religiöser Mann, der während seiner Kriegsdienste oft und oft den Feldgeistlichen supplierte und sogar eine Anzahl von Gebeten in Prosa und in Versen verfaßt hat.
Wahrscheinlich waren es seine soldatischen Abenteuer und seine Kriegsdienste, die in verleiteten, tiefer ins Glas zu schauen, als es wünschenswert gewesen wäre. Aus seinen Briefen an den großen Sohn jedoch, der selbst in seinen kraftgenialischen Jahren kein Kostverächter gewesen ist und bei Gelagen mit befreundeten Offizieren manchmal sogar unter den Tisch getrunken worden sein soll, spricht alles eher denn der Leichtsinn und die göttliche Sorglosigkeit des Trinkers.
Keinesfalls aber wird man Herrn Dr. Jerzabek unbedingt zustimmen können, wenn er Friedrich Schiller selbst gegen die moderne Auffassung vom Rechte der Frau auf Selbstbestimmung ausspielt. Angenommen, aber nicht zugegeben, daß Schillers Vater wirklich ein Alkoholiker gewesen sei, so würde daraus auf keinen Fall geschlossen werden können, daß es für die Volkswohlfahrt besonders zuträglich wäre, wenn Alkoholiker, Syphiliker und Wahnsinnige möglichst viele Kinder in die Welt setzen. Der gewissenhafte Arzt, der dem von einer unheilbaren krankgeit Heimgesuchten das Gegenteil des Bibelwortes: „Seid fruchtbar und mehret euch!“ zur Pflicht macht, wird sich kaum durch den Hinweis auf Friedrich Schiller und seinen Vater irre machen lassen.
Österreich darf sich nicht ausruhen
Die wirtschaftlichen Zeiten sind zu schwierig, um eine Atempause zu gestatten.
Neue Freie Presse am 7. Mai 1934
Das Wort, daß nach getaner Arbeit gut ruhen sei, darf gegenwärtig in Österreich keineswegs buchstäblich genommen werden. Wohl ist in der letzten Zeit viel geleistet worden. Doch die Arbeit, die hinter uns liegt, verpflichtet zu weiterer ernster Tätigkeit. Die Zeiten sind zu schwierig, um eine Atempause zu gestatten, ein selbstzufriedenes Verweilen bei dem Vollbrachten.
Es gilt vielmehr, sogleich an die Fortsetzung der bisherigen Wirksamkeit zu denken und aus den Ergebnissen der jüngsten Vergangenheit die trostreiche Zuversicht zu ziehen, daß dem Mutigen, dem Unternehmungslustigen selbst heute der Erfolg winkt, mag ihm auch nicht mehr die Welt gehören. Eines steht fest: Neben dem verfassungsrechtlichen und politischen Werk dürfen die Bemühungen um die Befruchtung, Stärkung und Unterstützung der Wirtschaft nicht zu kurz kommen.
Durch die Bankenfusion wurde der finanzielle Apparat umgestellt. Aus seiner Zusammenfassung ergibt sich leider die harte Notwendigkeit, den Beamtenkörper den geänderten Verhältnissen anzupassen. Allein dieses schwierige Problem kann nur dann richtig gelöst werden, wenn man den menschlichen Empfindungen gebührend Raum gewährt und wenn man bei der Aktion auf die Interessen der Gesamtheit Bedacht nimmt. Jede vermeidbare Verringerung der Konsumationskraft der Bevölkerung soll eben behutsam hintangehalten bleiben.
Eine schonungsvolle und verständnisvolle Behandlung erheischt auch die Zusammenlegung von Industriebetrieben, mit der man sich in der nächsten Zukunft prinzipiell und praktisch befassen wird. Jeder Mißgriff, jede Übereilung würde sich hier bitter rächen, denn es ist leicht, niederzureißen, aber schwer, aufzurichten. Als Hauptaufgabe muß jedoch die positive Förderung, die Belebung der Wirtschaft durch neue Impulse angesehen werden.
Ein Skandal weniger
Kleine und große Unsäglichkeiten sprießen derzeit aus dem Boden.
Neue Freie Presse am 6. Mai 1924
Ein Skandal ist aus der Welt geschafft worden. Oder wird wenigstens, wenn nicht alle Anzeichen trügen, in naher Frist von der Bildfläche der öffentlichen Diskussion verschwinden. Das ist immerhin bemerkenswert, in einer Zeit, da die Skandale, die gigantischen Riesenskandale und die kleinen niedlichen Skandälchen mit einer Ueppigkeit aus dem Boden schießen, wie die Pilze eines solche im feuchten Sommer nicht aufzuweisen haben. Wir meinen den Seeschlangenprozeß, den der ehemalige Theaterdirektor Amann seit Jahr und Tag gegen das Aerar zu führen genötigt ist, weil sogar ein Vierundachzigjähriger, mag er auch seine Ansprüche an das Leben ein auf ein Minimum beschränkt haben, mit 10.000 K. jährlich sein Auskommen nicht zu finden vermag.
Der Theaterdirektor hatte ein ihm gehöriges Heilbad einer Stiftung gewidmet, die für Militärwitwen und Militärwaisen bestimmt gewesen ist. Eine schöne Geste, die dadurch nicht beeinträchtigt wurde, daß der brave Mann, wenn auch dem Sprichwort getreu, zuletzt an sich nicht vollkommen vergaß und bis zu seinem und seiner Gattin Lebensende eine Jahresrente von 10.000 K. sich vorbehalten hatte. Ach ja! Es gab so eine Zeit, wo man zu sorgen aufgehört hatte, wenn man die stolze Gewißheit besaß, jahraus jahrein 10.000 K. einstreichen zu dürfen. So dachte auch der Herr Amann und er mag sich seinen Lebensabend wundernett vorgestellt haben. Da kam der Weltkrieg, der durch so viele Rechnungen hindurch blutige Striche machte.
(…) Er, der gespendet und aus vollen Händen gegeben hatte, sah sich über Nacht in die Rolle des läßtigen Bittsteller, des ohnmächtigen Bettlers verwiesen. Das Aerar war allerdings nicht kontraktbrüchig geworden. Gott behüte! Es zahlte vereinbarungsgemäß 10.000 K. Jahresrente und es zuckte überlegen die amtlichen Achseln bei dem Vorhalt, daß es genau genommen doch nicht mehr ganz dieselbe Rente sei. 10.000 K. Jahresrente, das ist heutzutage nicht nur zum Leben, sondern sogar zum Sterben zu wenig. Aber darüber ließ man sich hieramts, wie gesagt, keine grauen Haare wachsen.(...) Erst sehr spät scheint man auf den naheliegenden Gedanken gekommen zu sein, daß ein Ausgleich mit dem 84jährigen Greis den Staat aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ruinieren dürfte, daß das ganze Vorgehen gegen Herrn Amann alles genannt werden könne, nur nicht nobel. Dieser Mann hat denn doch verdient, mit einem anderen Maß gemessen zu werden, als seine Schicksalsgenossen, als alle jene, deren Ideal die Valorisierung ist. Die Republik Oesterreich, die sich sonst von den Sentimentalitäten des Festhaltens an Traditionen ganz gut verstand, hat überflüssigerweise bei dieser Gelegenheit ein Wort aus der Francesco-Josefinischen Zeit sich zu eigen gemacht, das Wort des Fürsten Schwarzenberg: Die Welt wird staunen, wie undankbar wir sein können!
Notruf der Frauen in Südtirol
Die deutsche Sprache soll in den Volksschulen erhalten bleiben.
Neue Freie Presse am 5. Mai 1924
Wie gemeldet, hat eine Abordnung deutscher Frauen dem italienischen Kronprinzen bei dessen Besuch in Bozen eine Schrift überreicht, in der sie ihn baten, für die Erhaltung der deutschen Unterrichtssprache in den Volksschulen ein einzutreten. In der Bittschrift heißt es:
„Die Verdrängung der deutschen Sprache aus den Schulen des Alto Adige bereitet uns Frauen so viel Sorge und Kummer, daß wir auch heute vor Eurer königlichen Hoheit wiederum die dringliche Bitte vorbringen müssen, uns das Heiligte, was ein Volk besitzt, seine Muttersprache, ungeschmälert zu belassen und sohin den Volksschulunterricht in der Muttersprache wieder herzustellen.
Eure königliche Hoheit der erlauchte Sproß eines alten Königsgeschlechtes, wird es gewiß als Pflicht der Menschlichkeit und des Edelsinnes empfinden, ein kleines, anderssprachiges, in die Grenzen Italiens ein eingeschlossenes Volk nicht unterdrücken zu lassen.
Ihr Wunsch kann es nur sein, daß alle Bewohner des Staates sich in demselben wohl fühlen und sich gegenseitig nähern, und gewiß würde nichts mehr dazu beitragen, die bei den Nationen zu gemeinschaftlicher Arbeit für das Wohl des ganzen Landes zu vereinigen, als die Gewißheit, daß es auch uns Deutschen möglich gemacht wird, unseren Kindern in erster Linie die Kenntnis der Muttersprache voll zu erhalten; wenn wir dessen sicher wären, würden unsere Kinder mit ganz anderem Eifer auch der Erlernung der italienischen Sprache sich widmen können.“
Mussolini und Machiavelli
Der Italiener will an der Universität promovieren.
Neue Freie Presse am 4. Mai 1924
Mussolini soll am 15. Juni zum Doktor der Universität Bologna, promoviert werden und hat der Universität eine Dissertation über Macchiavelli vorgelegt. Die Einleitung zu, dieser Dissertation wird jetzt von der faschistischen Zeitschrift “Gerarchia” veröffentlicht.
Mussolini untersucht die Frage, welcher lebendige Gehalt nach vier Jahrhunderten von Macchiavesllis “Principe” noch enthalten sei. Nach seiner Ansicht sei die Lehre Macchiavellis heute noch viel lebendiger als in der Vergangenheit. Interessant ist, wie Mussolini unter Beziehung auf die von Machiavelli im “Principe” geäußerten Ansichten die menschliche Natur beurteilt.
Mussolini sagt: “Schon bei einer oberflächlichen Lektüre des ‘Principe’ tritt deutlich der scharfe Pessimismus Macchiavellis hinsichtlich der menschlichen Natur hervor. Wie alle jene, welche in fortwährendem Verkehr mit ihren Nebenmenschen gestanden haben, ist Macchiavelli ein Verächter der Menschen und liebt es, sie in ihrer negativsten Gestalt darzustellen. Die Menschen sind nach Macchiavelli mehr den Dingen als ihrem eigenen Blute zugetan und bereit, Gefühle und Leidenschaftenzu ändern. Viel Zeit ist seither vergangen, aber wenn es mir erlaubt wäre, meine Zeitgenossen zu beurteilen, könnte ich in keiner Weise das Urteil Macchiavellis mildern, sondern müßte es noch verschärfen.”
An die Stelle des Wortes “Principe” müße man heute die Bezeichnung “Staat” setzen. Während die Individuen von ihrem Egoismus getrieben, dem sozialen Aktionismus zustreben, stelle der Staat eine Organisation und eine Begrenzung dar. Das Individuum strebe unaufhörlich danach, sich seinen Verpflichtungen zu entziehen, den Gesetzen nicht zu gehorchen, keine Steuern zu zahlen und keine Kriege zu führen.
Mussolini wendet sich hierauf im Sinne seiner bekannten Anschauungen gegen die Volkssouveränität, die er als einen tragischen Spaß bezeichnet, und erörtert dann die Anschauungen Macchiavellis über die Demokratie.
Die japanische Kaiserin kommt zu Besuch
Wer hätte sich gedacht, dass eine Herrscherin zu einem Kranken kommen würde?
Neue Freie Presse am 3. Mai 1924
Aus Jokohama wird uns geschrieben: In Numadfu war‘s. Einem kleinen Städtchen am Flusse Kannongawa. Im April, wenn in Nippon die Kirsche blüht. Die Aufregung auf der alten Tokaido, der Heerstraße, an der Numadfu liegt, war nicht zu verkennen. Ein Hasten und Laufen, Polizisten, die Befehle erteilten, Frauen, die die Straßen sprengten, Schulkinder, die sich zu beiden Seiten ins Spalier stellten. „Was gibt‘s? Wem gelten die Vorbereitungen?“ „Kogo hcka!“ Ihrer kaiserlichen Majestät. So hieß sie im Volke.
Wie alle ihre Vorgängerinnen seit dreihalbtausend Jahren. Nie wurde ihr Name genannt. Kaum wußte man, daß sie Haruko - der Frühling -hieß. Am Ende des Städtchens Numadsu wohnte ein japanischer Aristokrat; er lag damals am Fieber danieder. Und die Kaiserin hatte ihm ihren Besuch zugesagt. Mit Fahnen und violetten Vorhängen - violett ist die Farbe des Kaiserhauses - war die Wohnung des kranken Barons dekoriert. Vor dem Eingangstor hatte ein Schintopriester Ausstellung genommen, in gelbseidener Robe, das Holzszepter in der Hand. Um ihn herum die Schulmädchen in lila und bordeauroten Kimonos, ein glänzendes, orientalisches Bild. Ein Reiter, in Gehrock und Zylinder, kommt die Straße herabgesprengt. Ihm folgt, in weitem Abstand, die goldrote Hofequipage.
Einfach, schlicht, keine Spur von asiatischem Prunk. Drei Damen steigen aus, stellen sich rechts und links vom Wagenschlag auf. Dann eine Sekunde der Erwartung - und die Kaiserin entsteigt dem Innern der Equipage. In europäischem Kostüm: meergrünes Reisekleid, kleiner Hut, schwarzer Schleier. Langsam, sicher, nicht ohne Grazie bewegt sie sich durch das Spalier der sich tief neigenden Hofdamen.... Das also ist sie, die Gattin Mutsuhitos, die dem um zwei Jahre jüngeren Herrscher als achtzehnjähriges Mädchen angetraut worden war. Wie hat sich doch alles von Grund ans geändert seit dem Tage, da, die Wahl des Hofes auf sie als zukünftige Kaiserin fiel.
Damals war Japan noch ein feudaler Stadt. Die Zweischwertmänner herrschten noch im Lande und mehr als einmal hallten die weiten Säle des friedlichen Palastes in Kyoto vom klirrenden Schritt der Samurai, von Schwertarklang und Kriegsruf wider. Wilde Tage waren das, die dem endgültigen Sturze des allmächtigen Schoguns vorangingen! Schon sprachen zwar alle Zeichen dafür, daß der Sieg sich auf die kaiserliche Seite neigen werde. Daß der Mikado wieder eingesetzt werden würde in seine Herrscherrechte, die er, vor sieben Jahrhunderten, an die Adelsfamilie der Minamoto verloren hatte. Und doch, wer der jungen Haruko damals prophezeit hätte, daß sie eines Tages in schlichter Equipage in das Haus eines kranken Barons fahren würde, er wäre wohl für geistig nicht normal gehalten worden. Denn allgemein glaubte man damals, der Sturz des Schoguns würde die Wiederherstellung jener Zustände im Gefolge haben, wie sie vor dem Zwölften Jahrhundert gegolten hatten: ein zentralisierter Beamtenstaat, abgeschlossen gegen die Außenwelt, mit dem Mikado als alleinigem, aber dem Volke zeitlebens unsichtbarem Herrscher, dessen bloßer Anblick sterbliche Augen erblinden läßt.
Es kam anders, ganz anders. Die klugen Männer, die an der Spitze der Bewegung von 1867 standen, wußten mit den Institutionen des zwölften Jahrhunderts nichts anzufangen. Allzu laut, allzu ungestüm pochten Europa und Amerika an Nippons verschlossene Torei, verlangten Einlaß, drohten mit Gewalt. Die Zeit des Abschlusses, des Dornröschenschlafes war unwiederbringlich dahin. Mit dem Strome schwimmen, hieß es, oder in seinen Wellen untergehen. Und die Führer der Nation wählten das erstere. Auch sie, die Kaiserin aus dem Hause Fudschiwara, wurde mit Hinsingerissen in den Wirbel. Als der Mikado, unter dem starren Staunen seines Volkes, das tausendjährige Kyoto, die heilige Kaiserstadt, verließ und nach Norden zog, nach Tokio. Und als mit zunehmender Europäisierung Japans eine Mauer um die andere fiel, die zwischen Herrscher und Volk gestanden hatte, da trat auch die Kogo aus dem heiligen Dämmer der Abgeschlossenheit heraus ins helle Tageslicht der Öffentlichkeit. Mit natürlicher, ruhiger Grazie. Als wäre sie von Jugend auf dazu erzogen worden, vor allem Volke zu repräsentieren.
Die Schlafkrankheitsepidemie in England
In der Hauptsache sind junge Menschen zwischen zehn und zwanzig Jahren betroffen.
Neue Freie Presse am 2. Mai 1924
Das rapide Umsichgreifen der Encephalitis lethargia in England erregt im Lande größte Beunruhigung. Die Seuche erfaßt Personen jeden Alters. In der Hauptsache aber sind junge Menschen zwischen zehn und zwanzig Jahren betroffen.
Wie berichtet, sind in den ersten Wochen April 649 neue Fälle beobachtet worden. Das erhebt die Zahl der in diesem Jahre Erkrankten auf 1409, fast dreimal so viel als im Jahre 1922. Der Prozentsatz der Todesfälle ist leider sehr hoch. Er bewegt sich zwischen 25 und 50 Prozent. Von den in den ersten drei Wochen des Monates April erkrankten 649 Personen befürchtet man bei mäßiger Schätzung 160 Todesfälle, die doppelte Zahl dürfte auf lange Jahre oder gar für ihr Leben dauernden Schaden an Geist und Körper erleiden und nur ein Viertel der Opfer der Wiederherstellung zugeführt werden können.
Das Varieté auf dem Ozean
Auf hoher See kann es äußert langweilig werden. Das soll sich jetzt ändern.
Neue Freie Presse am 1. Mai 1914
Die modernen Ozeanriesen, die den Verkehr zwischen den deutschen, französischen oder englischen Häfen und Newyork vermitteln, haben längst das Außerordentlichste ersonnen, um die sechs- bis achttägige Reise angenehm, abwechslungsreich und amüsant zu gestalten. Schwimmbäder, Schiffsorchester, Feste unter Mitwirkung der Passagiere, unter denen es ja nie an großen Künstlern fehlt, fürstlich eingerichtete Salons, Spielzimmer und vor allem die Diners und Soupers mit ihren zehn und mehr Gängen sorgen dafür, daß die Fahrt recht rasch vergeht.
Und doch gibt es inmitten all dieses Luxus Stunden voll tödlicher Langweile.
Stunden, in denen man an nichts denkt als an die Meilenzahl, die man noch zurückzulegen hat, und besonders für die, die gewöhnt find, spät schlafen zu gehen, kann der Abend auf hoher See, wenn das Wetter den Aufenthalt auf Deck nicht erlaubt, alles eher als kurzweilig werden.
Nun geht die Cunardlinie daran, mich dem abzuhelfen. Ihr neuer Riesendampfer „Aquitania“, der am 29. Mai seine Jungfernreise vom Liverpool nach Newyork antritt, wird, wie die Londoner Blätter erzählen, ein vollständiges Varieté mit nehmen. Im Hauptsalon ist eine reguläre Bühne errichtet worden und eine halbe Stunde nach dem Souper wird dort eine Varietévorstellung beginnen, der auf bequemen Klubfauteuils 800 bis 1000 Personen bis Mitternacht beiwohnen können. Die Gesellschaft ist schon zusammengestellt: Frank Allen ist ihr Direktor, und sie enthält weltberühmte Artisten, wie George Robey, Barclay Gammon, die „Tiller-Girls“ usw.