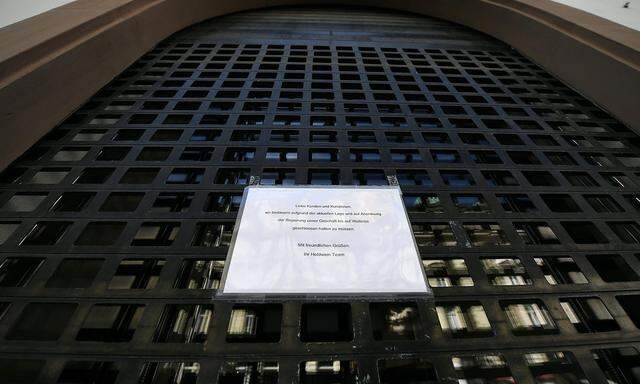Jeden Montag präsentiert die „Nationalökonomische Gesellschaft“ in Kooperation mit der „Presse“ aktuelle Themen aus der Sicht von Ökonomen. Heute: Julian Limberg und Laura Seelkopf über die Auswirkungen von Krisen auf unser Steuersystem.
Die Coronakrise hat den Steuerstaat erreicht. Staatseinnahmen versiegen, Sozialausgaben schnellen nach oben. Viele Länder verabschieden umfangreiche Konjunkturprogramme, um die wirtschaftliche Erholung zu beschleunigen. All das ist teuer und befeuert die Staatsverschuldung. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die Verbindlichkeiten reicher Industrienation im Jahr 2020 um durchschnittlich 17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigen werden. Mittlerweile nimmt die Diskussion über die Finanzierung der Krisenreaktionen Fahrt auf. Kurzfristige Steuererhöhungen sind jedoch unwahrscheinlich. In Zeiten niedriger Zinsen für Staatsanleihen könnten höhere Steuern den dringend herbeigesehnten ökonomischen Wiederaufschwung bremsen. Mittelfristig kann die Pandemie aber sogar zur Einführung komplett neuer Steuern führen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Krisen auch immer Antriebsfedern der Modernisierung des Steuerstaates waren.
Jeden Montag gestaltet die „Nationalökonomische Gesellschaft" (NOeG) in Kooperation mit der "Presse" einen Blog-Beitrag zu einem aktuellen ökonomischen Thema. Die NOeG ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Wirtschaftswissenschaften.
Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der „Presse"-Redaktion entsprechen.
„Allein noch viel größer als die ursächliche ist noch die symptomatische Bedeutung der Finanzgeschichte. (…) Wer ihre Botschaft zu hören versteht, der hört da deutlicher als irgendwo den Donner der Weltgeschichte“, schrieb der Grazer Ökonomieprofessor und Finanzminister Joseph Schumpeter in seinem weltberühmten Aufsatz „Die Krise des Steuerstaates“ aus dem Jahr 1918. Zu dieser Zeit wütete die Spanische Grippe und setzte Staaten weltweit unter Druck. Zusätzlich belasteten die Kosten des Ersten Weltkrieges die österreichische Staatskasse schwer. Schumpeter forderte daher eine höhere Besteuerung von Vermögen. Dies wurde allerdings erst nach seinem Ausscheiden aus der Regierung durch ein umfangreiches Reformprogramm umgesetzt, welches unter anderem eine allgemeine Vermögenssteuer etablierte. Des Weiteren wurden vorhandene Steuern erhöht und Kanzler Seipel führte im Jahr 1923 eine allgemeine Umsatzsteuer ein. Die Steuer ist heute nicht mehr aus dem österreichischen Steuersystem wegzudenken. Im Jahr 2018 machte die Umsatzsteuer mehr als 18 Prozent der Staatseinnahmen aus.
Österreich ist bei weitem kein Einzelfall. Weltweit liegen die Wurzeln des modernen Steuerstaates in Krisen und Kriegen. Insbesondere Steuern auf Einkommen und Konsum waren häufig aus der fiskalpolitischen Not heraus geboren. Abbildung 1 veranschaulicht dies. Speziell zu Zeiten der beiden Weltkriege und der Weltwirtschaftskrise führten viele Länder Einkommen- und Konsumsteuern ein. Heute ist es schwer, sich einen modernen Staat ohne diese Einnahmequellen vorzustellen.
Abbildung 1: Einführung von Einkommen- und Konsumsteuern im 20. Jahrhundert

Quelle: Tax Introduction Dataset. Daten für 47 Staaten, die bereits im Jahr 1900 unabhängig waren.
Wird die Coronkrise einen ähnlichen Modernisierungseffekt auf den Steuerstaat haben? Fiskalpolitische Prognosen sind notorisch schwierig. Die Geschichte zeigt uns jedoch, dass drei Faktoren wichtig sind. Erstens kommt es auf die Kapazität des bestehenden Steuersystems an. Effektive Steuerstaaten wie Österreich sind eher in der Lage, bestehende Steuern auszuweiten. Länder mit geringerer fiskalpolitischer Kapazität werden hingegen auf die Einführung neuer Steuern angewiesen sein. Dies trifft aktuell vor allem auf Staaten mit großen Ölreserven zu, die bisher kaum Steuern auf Einkommen und Konsum erheben.
Zweitens zeigen uns die Steuerreformen der letzten 150 Jahre, dass Gerechtigkeitswahrnehmungen zentral sind, wenn es darum geht, wer stärker besteuert wird. Steuerprogressivität stieg in Krisenzeiten vor allem dann an, wenn Reichtum als unverdient empfunden wurde. Wer für Reichensteuern eintritt, braucht daher überzeugende Argumente dafür, dass Reiche in der Coronakrise einen unfairen Vorteil genießen. Aus vergangenen Pandemien wissen wir, dass dies häufig der Fall war. Während beispielsweise kurzfristig alle gleichermaßen von der Pest betroffen waren, starben langfristig prozentual deutlich mehr Arme als Reiche, da sich diese besser schützen konnten. Auch in der aktuellen Krise gibt es erste Anzeichen, dass die Lasten nicht gleich verteilt sind, sondern Ärmere stärker leiden. Dies wenigstens fiskalisch auszugleichen, scheint also ein plausibles Argument.
Drittens spielen gesellschaftliche Koalitionen eine wesentliche Rolle. So war beispielsweise der Aufstieg der Einkommensteuer stark von der Unterstützung durch die Arbeiterklasse, Bauernverbände und neue industrielle Eliten getrieben. Ob aktuell diskutierte Maßnahmen wie CO2-Steuern, Vermögensteuern und Digitalsteuern den gleichen Siegeszug antreten wie Konsum- und Einkommensteuern, hängt also auch davon ab, ob sie Unterstützung durch breite gesellschaftliche Bündnisse finden. Auch dies erscheint wahrscheinlich. Die Forderung nach einer Vermögenssteuer wird nicht nur in Österreich immer lauter. International erhält die Steuer Unterstützung von unerwarteter Seite: Die „Millionaires for Humanity“ fordern ihre Regierungen auf, sie stärker zu besteuern, um die Folgen von Corona finanziell schultern zu können.
Steuerpolitische Erneuerung ist immer auch Ausdruck gesellschaftlichen Umbruchs. Die Geschichte zeigt, dass die derzeitigen Voraussetzungen für eine Modernisierung des Steuerstaates nicht die schlechtesten sind.
Die Autoren
Julian Limberg ist Lecturer für Public Policy am King’s College London. Seine Forschung beschäftigt sich mit Staatskapazität, Umverteilung und der historischen Entwicklung von Steuersystemen.
Laura Seelkopf ist Juniorprofessorin für Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie forscht zu Steuer- und Sozialpolitik im historischen und weltweiten Vergleich.

Weiterführende Literatur
Genschel, Philipp, and Laura Seelkopf. 2019. “Codebook – Tax Introduction Dataset (TID). Version May 2019.” Florence: European University Institute.
Schumpeter, Joseph. 1918. Die Krise des Steuerstaats. Graz: Leuschner and Lubensky.
Seelkopf, Laura, Moritz Bubek, Edgars Eihmanis, Joseph Ganderson, Julian Limberg, Youssef Mnaili, Paula Zuluaga, and Philipp Genschel. 2019. “The Rise of Modern Taxation: A New Comprehensive Dataset of Tax Introductions Worldwide.” The Review of International Organizations, May. https://doi.org/10.1007/s11558-019-09359-9