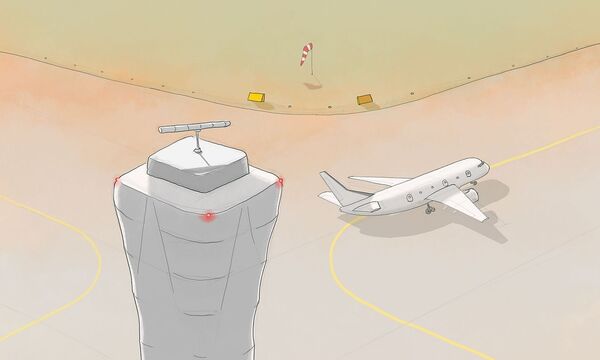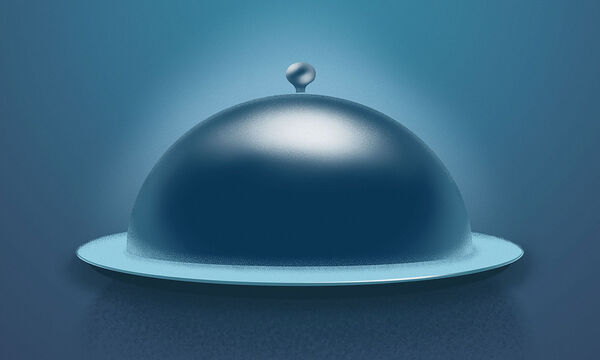Rund 63.000 Menschen arbeiten heute in Österreich in Pflegeberufen. 2050 wird es Bedarf für 80.000 weitere Mitarbeiter geben. Doch sie zu finden wird alles andere als einfach.
Die Berufsgruppe ist heute schon groß. Rund 63.000 Menschen sind offiziell in Österreich in der Pflege beschäftigt. Und sie decken viele Aufgaben ab: Sie sind mobil wie stationär im Einsatz, in privaten Haushalten wie in Kliniken, unterstützen Pflegebedürftige unabhängig von deren Alter in der Alltagsbewältigung und übernehmen Aufgaben bis hin zu medizinischen und diagnostischen Tätigkeiten.
Und die Nachfrage nach ihnen ist enorm. Nach einer aktuellen Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) werden bis zum Jahr 2030 gut 24.000 zusätzliche Mitarbeiter in der Pflege benötigt. Bis zum Jahr 2050 soll es Bedarf an rund 80.000 weiteren Pflegekräften geben. Da viele Pflegerinnen und Pfleger in Teilzeit arbeiten, entspricht das rund 58.000 Vollzeitäquivalenten.
Das wird schwierig. Denn schon jetzt können bei Weitem nicht alle Stellen besetzt werden. Das Image der Pflegeberufe ist nicht berauschend. „Die derzeitige öffentliche Debatte ,Pflege‘ wird ausschließlich über die 24-Stunden-Betreuung geführt und meint damit eine Personengruppe ohne Ausbildung nach den Bestimmungen des Hausbetreuungsgesetzes und der Gewerbeordnung“, sagt Roswitha Engel, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft an der FH Campus Wien. Es handelt sich dabei um „Laienpflege“ und nicht um berufliche Gesundheits- und Krankenpflege. „Es ist an der Zeit, die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe der breiten Öffentlichkeit differenziert darzustellen und die respektablen Ausbildungslevels und vielfältigen Karrierewege anzuerkennen.“ Das würde jungen Menschen den Zugang zu derartigen Berufen erleichtern und sie positiv beeinflussen.
Mit der Gesetzesnovelle im Jahr 2016 wurde die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung österreichweit auf drei Ausbildungslevels aufgeteilt: Es gibt die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz (früher Pflegehilfe), die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz und das dreijährige Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege im gehobenen Dienst, das die frühere Diplomausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege ablöst.
Die einheitlichen Ausbildungsregelungen sollen dafür sorgen, das Image zu verbessern. Daneben braucht es aber auch viel Öffentlichkeitsarbeit. „Das heißt, mehr Information über den anspruchsvollen Alltag einer Pflegekraft“, sagt Gabriele Hintermayer, vom Berufsverband Kinderkrankenpflege. Und das heißt auch, darüber zu sprechen, welche Auswirkungen die Digitalisierung hat. So besteht in der Branche die Hoffnung, dass die Digitalisierung bestimmte Tätigkeiten erleichtert bzw. auch obsolet macht. Ohne dass Pflegeroboter eingesetzt werden.
Dass die Ausbildung zur Pflegeassistenz erst mit 17 Jahren begonnen werden kann, ist international Standard. Daran möchte Ursula Frohner, Präsidentin des Gesundheits- und Krankenpflegeverbands, nichts ändern. Denn „die Ausgebildeten sollen im Beruf bleiben und nicht in jungen Jahren überfordert werden“, sagt sie. Frohner spricht sich aber dafür aus, eine Möglichkeit zu schaffen, die Berufsausbildung vor dem 17. Geburtstag zu starten und zunächst administrative und serviceorientierte Themen zu lehren.
Pläne des Bildungsministeriums, die in diese Richtung gehen, begrüßt auch die Caritas: Angedacht sind berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMS bzw. BHS) für Pflege bzw. für Sozial- und Gesundheitsberufe.
Nicht einer Meinung ist man in der Branche, ob es eine betriebliche Ausbildung geben sollte. Die einen meinen, die Schweiz etwa habe mit der Pflegelehre gute Erfahrungen gemacht. Die anderen halten nichts davon, die Pflegeassistenz als Lehrberuf einzurichten.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.05.2019)